_______________________________
Februar 2026
|
|
|
Banana Yoshimoto „Kitchen“, Diogenes 1992, EA 1988
Eigentlich müsste es ein Buch sein, das uns von Beginn an verzweifeln lässt. Die Handlung setzt ein, als die Protagonistin Mikage von ihrer letzten lebenden Verwandten, der Großmutter, Abschied nehmen muss. Geblieben ist ihr die kleine Wohnung mit der Küche, ein tröstlicher Gedanke für sie, die den warmen Raum der Küche mit seinen Gerüchen, seinem Durcheinander als Ort der lebensspendenden Versorgung mit den köstlichsten Gerichten verbindet. Manchmal, wenn ich total am Ende bin, denke ich mir: Wenn ich einmal sterben muß, dann will ich meinen letzten Atemzug in einer Küche tun. (S. 9). Yuichi Tanabe, ein gleichaltriger Studienkollege und Bekannter der Großmutter, unterstützt Mikage in den schweren Stunden und bietet ihr schließlich an, bei sich und seiner Mutter einzuziehen – für die Zeit der Suche nach einer neuen leistbaren Wohnung.
Mikage, die das Angebot annimmt, findet auf dem ausladenden Sofa der Familie ebenso wie in deren Küche einen Hafen des Beschütztseins, der sie an der Trauer und der Angst vor dem Alleinsein vorbeinavigiert. Mit Yuichi kommt auch Eriko, dessen Mutter, ins Spiel – eine hart arbeitende Nachtclubbesitzerin, die Mikage sofort mit wehenden Kleidzipfeln ins gemeinsame Leben aufnimmt und bei der ersten Begegnung schon eine Faszination auf die junge Frau ausübt, die sie kaum in Worte zu fassen bekommt:
Bei genauerem Hinsehen waren mir doch die kleinen Fältchen aufgefallen, die in diesem Alter durchaus normal sind, und auch ihre Zähne waren nicht ganz regelmäßig. Sie hatte durchaus etwas Menschliches an sich. Dennoch war ich wie weggetreten. Ich hätte sie am liebsten gleich noch einmal angesehen.
(S. 20)
Erst später erzählt Yuichi, dass er Eriko Mutter nenne, obwohl sie irgendwann einmal sein Vater gewesen war. Den Weg zu dem Leben, das sie wirklich leben wollte, hatte sie nach dem Tod von Yuichis biologischer Mutter selbstbewusst genommen.
Sowohl Eriko als auch Yuichi empfangen Mikage als selbstverständlichen Teil der Familie in ihrem Leben, federn ab, was an Trauer und Verlust in ihrer aller Leben wabert.
So endet das erste Kapitel „Kitchen“ und vielleicht wäre es bekömmlich, hier auch das Buch zur Seite zu legen. Dann aber regt die Neugierde an, in dem schlanken Büchlein weiterzulesen, und wer sich die Lektüre nicht spoilern lassen möchte, sei nun sanft aus diesem Lesetipp verabschiedet. Lesen Sie „Kitchen“, es wird Ihnen gefallen.
----------
Mit dem Umblättern des zweiten Kapitels „Vollmond“ reißt der erste Satz eine Lücke in alles Bisherige Ende März war Eriko tot. Ein Verrückter hatte ihr nachgestellt und sie umgebracht. (S. 59)
Erneut schlägt der Tod eine Lücke in das Leben und erneut ist Mikage gefordert, den Verlust mit der Zuversicht des Weiterlebens auszubalancieren. Dies gelingt hier mehr, dort weniger, und immer bleibt die Geschichte der Ich-Erzählerin auch eine Geschichte des Erinnerns und der Gegenwärtigkeit, die Trost spenden kann. So verläuft sich die an sich gerade und nüchterne Erzählstimme hinter der Protagonistin hin und wieder in Beobachtungen, die das Lesen zu einer beinahe haptischen Erfahrung werden lassen; etwa wenn Mikage gemeinsam mit Eriko Reissuppe mit Ei und Gurkensalat am Küchenboden frühstückt, die Grünteetasse vom einfallenden Sonnenlicht fast durchsichtig scheint und die Pflanzen auf dem Fenstersims in weiches Licht gehüllt leuchten. Lebendigkeit entfaltet sich aber auch in der Beziehung von Eriko, Mikage und Yuichi und der ausgeglichenen Charakterzeichnung, die Banana Yoshimoto gleichberechtigt nebeneinanderstellt.
Die Erzählung selbst ist solcherart auch genug. Keine Mittel der emotionalen Erpressung der Leser*innen sind notwendig, um uns an die Lektüre zu binden. Langsam und stetig entfaltet sich die Beziehung dreier zufälliger Menschen, ist zeitweise zum Weinen und dann wieder heilsam komisch. So begleiten wir Mikage in den Winter hinein und trennen uns nur ungern von den Bildern, die sie in uns zurücklässt.
Mit ihrem Debütroman „Kitchen“ löste Banana Yoshimoto (* 1964) bei seiner Veröffentlichung 1988 eine Begeisterung aus, die sie zu einer der meistgelesenen Autor*innen Japans avancieren ließ. Gleich zweimal wurde „Kitchen“ filmisch adaptiert (1989 (Japan) und 1997 (Japan/China)). Die weltweite Popularität der Autorin schlägt sich auch in einer breiten Übersetzung nieder – ihre Werke erschienen in über 30 Ländern.
Iris Gassenbauer |
|
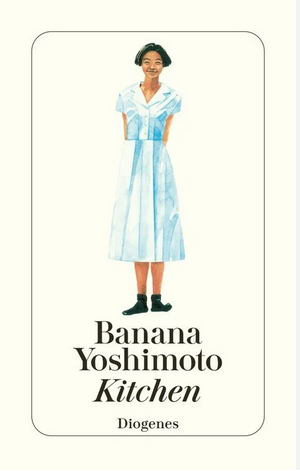
|
_______________________________
Jänner 2026
|
|
|
Christina Dalcher: "Vox". S. Fischer, 2018.
Wissen Sie, wie viele Wörter Sie am Tag sprechen? Dr. Jean McClellan weiß es ganz genau, denn wenn ihr das 100. Wort an einem Tag über die Lippen gekommen ist, erhält sie für das 101. einen Stromschlag über den Wortzähler an ihrem Handgelenk, der sie in die Ohnmacht schickt. Mit dieser elektronischen Handfessel ist sie aber nicht alleine oder etwa aufgrund eines Verbrechens gestraft – nein, sie ist in der dystopischen Realität des Romans „Vox“ zur Realität geworden. Denn während in diesem nicht allzu weit entfernten Amerika die Bewegung der Reinen, einer pseudochristlichen Vereinigung extremer Nationalisten, an die Macht gekommen ist, bleibt für die Frauen der Reinen als angestammtes Habitat nur noch Haus und Herd. Da hierfür das Sprechen nicht förderlich – sondern ganz im Gegenteil – unerwünscht ist, wurden nach politischen Gegenerinnen nach und nach alle Frauen und Mädchen mit Wortzählern ausgestattet. Solcherart mundtot lebt Jeanne, vormalige Neurowissenschaftlerin, wütend und gefangen im Alltag einer Hausmutter, die vier Kinder und ihren Mann umsorgt und jede Kommunikation auf ein frustriertes Minimum herabgeschraubt hat. Bewegung kommt ins Spiel, als ihre Dienste und ihr Fachwissen zum Einsatz kommen sollen, nachdem der Bruder des Präsidenten bei einem Unfall verletzt wurde. Jean sieht die Chance, ihre Tochter freizuhandeln, und muss bald erkennen, dass die Indoktrinierung der Bewegung der Reinen schon konsequent in das Innerste ihrer Familie gedrungen ist. Was dieser Erkenntnis folgt, sind rund 400 Seiten zwischen Thriller, Dystopie und – ja, tatsächlich – Liebesgeschichte, schnell und nicht auf den Mund gefallen aus der Ich-Perspektive der Protagonistin erzählt.
Wenn Ihnen nun Vergleiche mit Margaret Atwoods „Report der Magd“in den Sinn kommen oder auch die Klassiker wie Aldous Huxleys „Schöne neue Welt“ oder natürlich Georg Orwells „1984“, so sind Sie damit nicht alleine. Christina Dalchers Romandebüt „Vox“ erschien 2018, zwei Jahre nachdem Trump zum ersten Mal als Präsident der USA die Weltbühne verunsichert hatte. In diesem Klima der Rückkehr zu Tradwifes und Make America Great Again-Fatalisten entstand mit dem Roman eine verständliche Reaktion auf die zeitgeschichtlichen Regressionen – eine Reaktion, die weder sprachlich noch inhaltlich als glänzendes literarisches Beispiel die Bestenlisten toppen kann. Wieso aber bekommt sie nun den Sockelplatz des Lesetipps des Monats?
Nun, der Roman ist, in all seinen überbordenden Handlungssträngen, mager ausgearbeiteten Nebenfiguren, aktionsgetriebenen Wendungen, stark konstruierten Zufallsmomenten und der durchaus voraussehbaren Handlung, kein Meisterinnenwerk, aber er ist dennoch höchst lesenswert. Denn was Christina Dalcher gelingt, ist es, ein (wenn auch nicht perfekt ausgearbeitetes) Setting zu schaffen, von dem ausgehend glänzend erzählt wird, wie sich eine Gesellschaft in nur wenigen Drehungen in eine Richtung entwickeln kann, die so rasch und konsequent neue Regeln und Strukturen etabliert, dass ein Zurück schon nach kurzer Zeit undenkbar ist. Eine Gesellschaft, die Persönlichkeitsverletzungen unter das Schlaglicht des Wohles für alle stellt, wie eine der machtvollen Nebenfiguren, Morgan LeBron der Protagonistin entgegenspuckt:
Sie müssen es in Ihren Schädel bekommen, Jean. Auf euch Frauen kann man sich nicht verlassen. Das System arbeitet nicht mehr so wie früher. Nehmen Sie die fünfziger Jahre. Alles war gut. Alle hatten ein hübsches Haus und ein Auto in der Garage und Essen auf dem Tisch. Und alles liegt glatt! Wir brauchten keine Frauen als Arbeitskräfte. Sie werden es kapieren, sobald Sie diese ganze Wut verdaut haben. Sie werden sehen, dass es besser wird. Besser für Ihre Kinder.“ (S. 217)
Wie Jeans eigener ältester Sohn mit den neuen Grundsätzen und Werten der Reinen konform geht und sie unreflektiert reproduziert, wie die kleine Tochter eifrig den ganzen Tag freiwillig schweigt, um im Wettbewerb um die Reinste ihrer Klasse eine Leckerei zu gewinnen, wie Fernsehprogramme öffentliche Demütigungen in das zensierte Programm spulen und dabei Anteilnahme täuschen – all das sind Details der Handlung, die Christina Dalchers Roman zu einer wirkungsvollen Warnung machen. Und die ist allemal stärker als die Schwächen eines Textes, der 2018 noch nicht vorausgesehen hat, dass mit dem Enden der ersten Amtsperiode des amerikanischen Präsidenten der Spuk noch nicht vorbei sein würde…
Iris Gassenbauer |
|
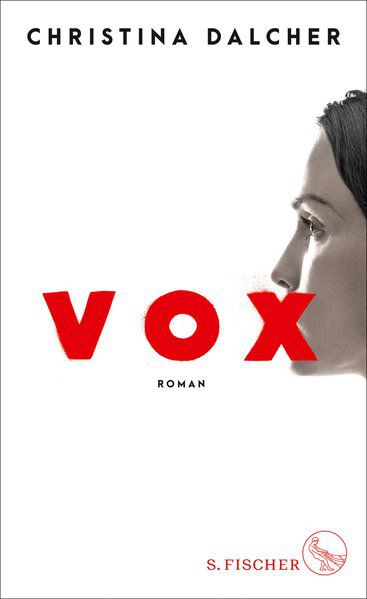
|
_______________________________
Dezember 2025
|
|
|
Jegana Dschabbarowa: Die Hände der Frauen meiner Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt. Zsolnay 2025
Jegana Dschabbarowa: Die Hände der Frauen meiner Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt. Zsolnay 2025
Da ist der Körper der Frau, wie er ihr gehört und wie er ihr nicht gehört. Wie und wozu er ist. Und: wozu er nicht ist. Zum Schreiben ist er nicht. Zum Sprechen ist er nicht. Zum Freitun, Für-sich-selbst-Tun und zum Wehren ist er nicht.
Da sind die Augenbrauen, die Haare, der Hals, da ist Rücken, Mund, Schultern und da sind die Hände der Frauen, die Essen auftragen sollen und Arbeit verrichten und nur an Hochzeitsfesttagen goldringgeschmückt und manikürt tanzen dürfen. Schreiben sollen sie nicht, diese Hände der Frauen aus der Familie der aserbeidschanischen Ich-Erzählerin, die in Russland als Minderheit den Stand des Außenbleibens haben. Reden soll der Mund nicht und schweigen soll er über die Gewalt, die dem Rücken, den Schultern und dem Hals der Frauen angetan.
In der Welt, in der ich aufgewachsen bin, war jeder noch so kleine Winkel von Blicken durchbohrt […] Das Erste, was uns Mutter sagte, sobald wir laufen und über die Schwelle des Elternhauses zu treten gelernt hatten: Alles hat Augen. Und weswegen müssten wir immer auf uns achten, darauf wie andere uns sahen, weil wir nicht bloß die geliebten Kinder unsere Eltern waren, sondern auch ihr Kapitel, ihr Ruf, ihre Ehre, ihr Gesicht.
(S. 31)
Allgegenwärtig sind diese Blicke also, und wertend sind sie auch – gleichzeitig lenkt die Erzählerin auch unseren lesenden Blick auf die Wanderkarte des Körpers der aserbeidschanischen Frauen und kuratiert ihn vom Scheitel bis zur Sohle. Kapitelweise werden wir selbst zu Zeug*innen der Fremdbestimmung und der ständigen Verfügbarkeit, die Konstanten im Frauenalltag ausmachen. Verfügbar für Arbeit, verfügbar für Eifersucht der Ehemänner, verfügbar für den Tratsch der anderen.
So erzählt sich die Protagonistin durch die Körperabschnitte und zugleich durch eine Kulturgeschichte vernarbter Körperlichkeit. Von verfestigten Routinen häuslicher Gewalt und geheimgehegter Freuden der Frauen unter sich, vom Ducken und Aufrichten ihrer Mutter und Großmütter, von den Tanten und den Kinderbäuchen und von sich selbst und dem eigenen, kaputten Körper, der an Dystonie erkrankt ist und mehr und mehr versteift. Zwischendurch lockert sich der Blick auf die Allgegenwart des begrenzten Körpers und tauscht Platz mit dem Zurückerinnern der Vorfahrinnen:
Wegen des Krebses hatte Großmutter oft Hitzewallungen, es schnürte ihr die Kehle zusammen, sie öffnete im kleinen Schlafzimmer alle Fenster und legte sich auf den Fußboden davor; manchmal, wenn der Schmerz sie nachts plagte, ging sie auf den Balkon und betrachtete den georgischen Himmel. Der georgische Himmel ist schöner als alles, was ich je gesehen habe; Die große Pupille des Vollmondes hing tief über der Erde, und es war, als brauche man nur hochzuhüpfen, um sie mit dem Finer zu berühren. […] Großmutter betrachtete die Sternkörper in deren Himmelssarg schweigend, sah zu, wie deren funkelnde weiße Sawans aufhörten zu strahlen, sich der Dunkelheit anverwandelten und zum Teil von ihr wurden. Sie wusste, dass dies das Los aller Erdbewohner war, doch es tat ihr leid, dass sie dort keine Kleidung würde nähen können, mit dem Pedal ihrer Nähmaschine klopfend. Im Sarg gab es keine Geräusche, dort kehrte die Sprache zum Schöpfer zurück.
(S. 118)
Die Worte der Erzählerin sind ohne Bedauern und ohne Mitleid; das hat es nicht nötig. Auch wenn sie über die Zerstörung des eigenen Körpers schreibt, bleibt ihr Ausdruck in der abgeklärten Distanz einer Erzählerin gehalten, die weiß, dass es nicht gut ist, wie es ist, die aber auch weiß, dass die Umstände unabänderlich in die Geschichte gestanzt sind. Hadert sie mit ihrem Leben? Vielleicht. Ausdruck findet es nicht, das Urteil überlässt sie uns Lesenden.
Jegana Dschabbarowa, 2023 aus Russland geflohen, erschafft das schmucklose Bild einer Gegenwärtigkeit, das durch großes Talent für Zwischentöne einen gesellschaftlichen Tiefenblick zulässt. Kleinszenen werden durch die Detailbewusstheit ihrer Erzählung vertraut und machen den besonderen Reiz der Lektüre aus, etwa, wenn die Protagonistin erzählt:
Es war ein seltsames Gefühl: erwachsen zu sein und neben einem Elternteil im Bett zu schlafen. Die Körper hatten ihre Leichtigkeit und Bindung eingebüßt, sie wälzten sich behäbig hin und her und versuchten zufällige Berührungen zu vermeiden. Voneinander abgewandt, dachten wir Verschiedenes.
(S. 120)
Hier sammelt sich das Poetische der Sprache, die auch in ihrer Übersetzung aus dem Russischen aus einem soliden Guss gemacht ist.
iiris gassenbauer |
|

|
_______________________________
November 2025
|
|
|
Mieko Kanai: Leichter Schwindel, Suhrkamp 2002.
Ganz normal. Ganz normal sind die Ansprüche der Enddreißigerin Natsumi, die mit ihren zwei Söhnen und ihrem Mann in Tokio lebt, in einer Wohnung mit dem großen Balkon nach Süden und Osten und der geräumigen Wohnküche (S. 7), einer Wohnküche von zwölf Tatami und mit einem kleinen Pool im Hof, wo die Kinder jetzt noch plantschen, bald aber, so mutmaßt Natsumi, den kleinen Pool verachten und ihre eigenen Zimmer fordern würden, eigene Zimmer von mindestens acht Tatami in einer Wohnung, in deren Detailtreue sich die Protagonistin Natsumi versteigt und uns Leser*innen schon mit dem ersten Kapitel wortüberflutet; der erste Satz endet erst auf Seite zehn. Ganz normal entrollt sich Natsumis Leben zwischen der routinierten Unaufgeregtheit des ewig Gleichen,
den Kindern, dem Einkauf, der Wäsche, den Kindern, dem Sorgen, dem Austausch mit der Nebenmieterin, den Kindern, dem Mann und dem Sorgen und zwischen der kribbelnden Unruhe ob der starren Gegenwart. Natsumi verheddert sich in den Kleinstbestandteilen ihres Alltags, aufgebauschten Bevormundungen der Mutter und den Nebensächlichkeiten, für die andere Erzähler*innen keinen Blick hätten. Der Gang zum Supermarkt entrollt sich narrativ zur seitenlangen Aneinanderreihung der Produktkette und leitet die Belanglosigkeit der Repetition ein, die Natsumis Leben prägt. So weit geht es, dass sich die Einkaufslisten wöchentlich gleichen und
Natsumi, ohne sich zu erinnern, noch reichlich zu haben, die wieder gleichen Produkte kauft. Das nennt man wohl ein Déjà-vu. Das passiert, wenn du erwachsen und noch dazu Hausfrau bist. So ein Déjà-vu verursacht Übelkeit und Schwindel, sagte Natsumi zu Setchan, und weil es an diesem Tag geregnet hatte, ging sie erst gegen Abend einkaufen und beeilte sich so sehr, dass sie die zwölf Rollen Toilettenpapier im Sonderangebot an der Kasse vergaß und es erst zu Hause merkte. […] (S. 65)
Die Übelkeit der Wiederholung und der Schwindel, den sie auslöst, sind die Konstanten im Sein und Wirken der jungen Frau. Und auch auf formaler Ebene prägen Übelkeit und Schwindel das Erzählen; endlos sind die Sätze und detailverstiegen, nicht zum Schluss kommend und sich immer und immer wieder noch eine Tür öffnend, um erzählerisch in eine neue Richtung abzubiegen, bis wir Leser*innen schon lange nicht mehr wissen, wo es eigentlich begonnen hat, das Erzählen. Mieko Kanai, die den Roman aus schon veröffentlichten Episoden neu kuratierte, hält im Nachwort fest:
„Eine Frau, die über dreißig Jahre lebt, ohne dass es zu etwas Dramatischem wie einer Affäre oder dem Versuch, sich unabhängig zu machen oder selbst zu verwirklichen, kommt, während sie ab und zu grübelt, unter diesem oder jenem leidet, ergriffen ist und Entdeckungen macht, wird mit der Zeit diesen leichten Schwindel verspüren, nicht so herausragend, nicht so einschneidend, dass er bis in die Tiefen ihrer Existenz oder ihrer Seele vordringt, sondern ein Moment ist, in dem sie das Gefühl für sich selbst oder die eigenen Erinnerungen als etwas Frisches oder Neues, aber Unersetzliches empfindet. Dieses leichte Schwindelgefühl, das ich in meinem nicht sehr abwechslungsreichen Alltag selbst erlebe, hat mich, glaube ich, dazu angeregt, über diese Momente zu schreiben.“ (S. 174)
Solchermaßen durch die Gedankenwelt Natsumis geschleift, haben wir nur zwei Optionen: mit einem entschiedenen Stopp das Buch wieder zuzuklappen und die Übelkeit für uns selbst zu beenden. Oder aber sich dem leichten Schwindel der Protagonistin hinzugeben. Zweitere Option mag zwar anstrengend klingen, lohnt sich aber, sobald die eigene Ungeduld überwunden ist, mit einer lustvoll ausschweifenden und unaufdringlichen Sozialstudie des Japans der 1990er Jahre und dem Kleinstkosmos einer konstant Unterforderten.
Iris Gassenbauer |
|
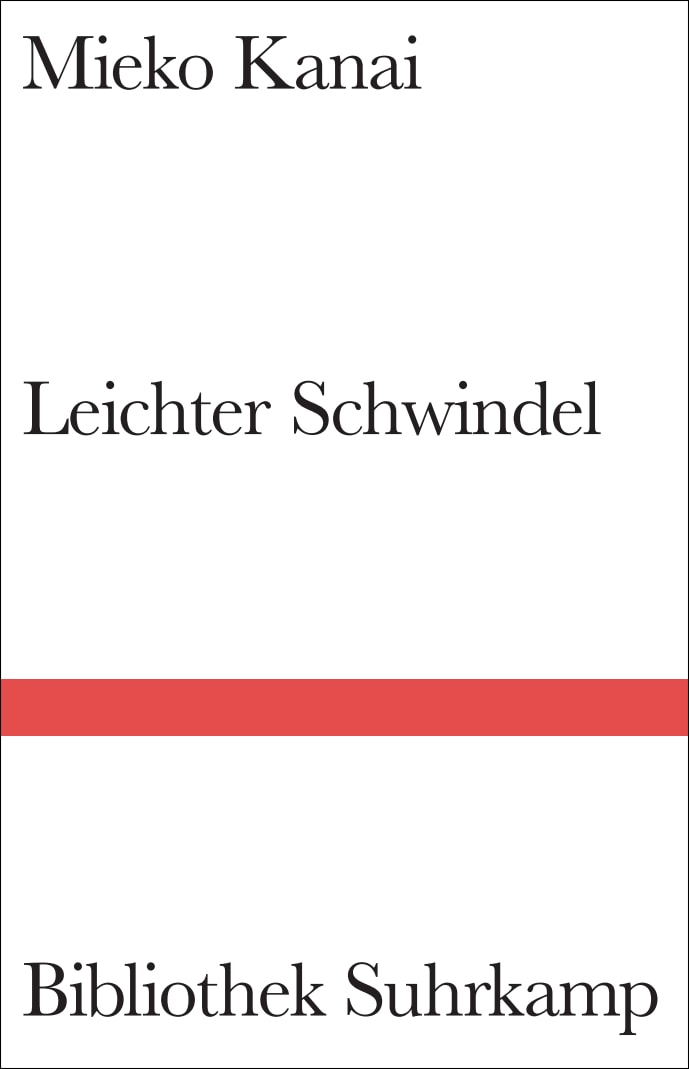
|
_______________________________
Oktober 2025
|
|
|
Susan Kreller: Das Herz von Kamp-Cornell, Carlsen Verlag 2025
Trübsal gibt es in vielen Lautstärken. Und in vielen Farben, möchte man anfügen, in Kornelkirschblütengelb und Kornelkirschfruchtblutrot, im Tantenliedschattenblau und im Federhaarweiß des Großvaters, der doch eigentlich schon längst, längst hätte tot sein müssen. Zumindest halbtot ist er, als die Familie auf einen das Trübsal anteasernden Brief hin an seinem Bett zusammenkommt, im Großvaterhaus in Kamp-Cornell, diesem Kaff außerhalb jeglicher Zivilisation. Die Familie, das sind die Tanten und die unweigerlich mit in die Misere geschleppten Cousins und Cousinen, die sich in einer neufamiliären Zweckgemeinschaft in dem knackenden und knirschenden Haus mit dem tropfenden Wasserhahn zusammenraufen müssen, Eigenheiten inklusive.
Dass etwas nicht ganz gerade ist im gelbblühenden Kaff und dem lärmenden Haus, dringt aus jeder verschwurbelten Situation der Erzählung; aus den Reisaufläufen mit Kornelkirschenmarmelade, die von den Dorfbewohner*innen mitgebracht werden und früher oder später scherbenreich am Küchenboden landen, aus den Stromausfällen und dem spätnächtlichen Gerumpel des Hauses, aus den schiefgefeilten und überlackierten Fingernägeln, die die Nagelstudiobetreiberin Inge hinterlässt. Und nicht zuletzt aus den CGs, die im ganzen Haus verteilt als rätselhafte Botschaften an die Nachwelt in Wände und Türen geritzt sind, 39 an der Zahl.
Naturgemäß ist man um Aufklärung bemüht – zumindest von Seiten der jungen Generation, während die ältere genau das Gegenteil anzustreben scheint: Vergessen, Vergraben, Hinunterweinen. Aber ganz so einfach lässt sich das Vergangene dann doch nicht in den Keller sperren.
Während Großvater Victor Melitzky nach und nach dem Halbreich der Toten entsteigt und als Poltermann ins Leben der Familie zurückkehrt, trägt der überflüssige Haufen von Cousins und Cousinen, diese ärgerliche Verschwendung von Verwandtschaftszuteilung (S. 97) (so zumindest in den Augen der andersnamigen Cousine Lu Winnefeld), ihre eigenen Grabenkämpfe gegen das Trübsal aus. Da ist Penelope mit den türkisfarbenen Haaren und eine besonnen durch die Szenen watschelnde Hühnergans, da ist Edin mit den Schwitzhänden und Johnny mit der Zwangsstörung, da sind aber auch noch Andrasch der tränenerfüllte Installateur, der Friedhofsgärtner Christian, ja auch die nasenamputierte Büste des Kaffgründers und alle, alle ahnen etwas, das sich erst nach und nach zu einem großen Ganzen fügen lässt. Und als es endlich so weit ist, dass auch wir Lesenden dieses große Ganze zu fassen bekommen, dass wir den Einstieg in den Irrgarten gleich hinter dem Haus und den Knopf gefunden haben, der das Sesamöffnedich aktiviert, sind noch immer nicht alle Fragen zu Ende beantwortet. Man kann ja nicht alles wissen.
((S. 286) Anm. der Autorin des Lesetipps: eine blasphemische Handlung, den letzten Satz eines literarischen Werks zu zitieren, aber in diesem Fall der wohl unspoilerhafteste Satz überhaupt und zugleich so allumfassend passend, deshalb sei es verziehen.)
Nein, Susan Kreller spielt das Spiel des Ungewissen und Unheimlichen lehrmeisterinnenhaft und füttert immer gerade so viel zu, dass sich in den kleinen Geräuschen und Randgesten ein ganz eigener Schauer einnisten kann. Was aber besonders aus dem Text sticht und für die Autorin – die Fanbase weiß das längst – prototypisch ist, ist eine Sprache, die über Konventionen und Gemeinplätze tänzelt, als wären es heiße Kohlen, und dabei ganz neue Bilder erschafft.
Hier auf Satzstrukturen und Kleinstbeobachtungen aufmerksam zu sein, lohnt sich sehr. Das mag die Lektüre verlangsamen (was nicht zuletzt auch an einer Erzählung liegt, die es nicht eilig hat, vom Fleck zu kommen), es bereichert sie aber zugleich ungemein. So entsteht in der Mehrperspektivität des Erzählens, in den nicht ganz geradelaufenden Narrationen und dem angeschnörkelten Beiwerk, das Kreller so geschickt um die Handlungsstränge windet, der Eindruck, die eigentliche Nachricht als kleines Geheimnis zu entdecken. Das Herz der Lektüre liegt somit nicht auf den Lippen, sondern hinter den Weisheitszähnen, stets ein wenig im Verborgenen. Wer sich dem Erzähltempo anpasst und mit staunendem Blick folgt, wird darin aber – anders als Cousins und Cousinen, Tanten, Gärtner, Nagelstudiobetreiberinnen und Installateure – das Glück finden.
iris gassenbauer |
|

|
_______________________________
September 2025
|
|
|
Marlene Streeruwitz: Die Reise einer jungen Anarchistin in Griechenland. S. Fischer 2014
Cornelia ist zu spät. Zu spät für die Fähre, die sie nach Athen bringen soll, zu Marios, dem jungen Rebellen, zur Demo gegen die Verhaftung vermeintlich illegaler Sexarbeiterinnen. Cornelia verpasst also den Anschluss und verpasst zugleich den geplanten Ablauf einer anarchistischen Intervention im fremden Land. Dafür beginnt die Stücklung einer Reise, die zwischen Odyssee und Roadmovie liegt. So wird ihr nach der verpassten Fähre eine (von vielen) Mitfahrgelegenheit angeboten und das scheinbar umsonst.
Es würde nichts kosten, „it would be for free“, und ich könnte in der Nacht in Athen sein, sagte der Mann. Mit der Fähre konnte ich auch nicht früher da sein, und ich schaute wahrscheinlich deswegen interessiert drein. Der Mann redete gleich so dringlich weiter und pries das Segelschiff an und die Skipper, und ich bekäme einen Segeltörn umsonst. Ich musste lachen. Was sollte das denn sein, eine kostenlose Segelpartie? So etwas gab es doch nicht. Doch, doch, sagte der Mann und lachte auch. Es gäbe Wunder auf dieser Welt, und diese Möglichkeit sei eines.
(S. 50)
Cornelia nutzt die Chance gegen ihr Bauchgefühl, schifft live in eine dubiose Güterübergabe, fühlt sich recht unwohl und verlässt Bord über die Reeling. So folgt Mitfahrgelegenheit nach Mitfahrgelegenheit und so folgt auch eine Begleitfigur nach der anderen. Es sind Frauen, mit denen die knapp 18-Jährige Solidarisierung findet – auch wenn dies nur holprig vorangeht und schlussendlich die Reise doch noch gelingt. In Athen aber ist Marios, der Anarchist, noch immer nicht zu finden, dafür gerät Cornelia in die Wirren und die plötzlich gewaltvolle Realität der Demonstration. Da wabert Tränengas, da packen Polizisten ein bisschen gröber zu als notwendig, da fällt schließlich auch für Cornelia eine Gefängniszellentür ins Schloss. Am Ende löst sich dann doch alles wieder. Cornelia bleibt freie und wenig bedeutende Tourist-Anarchistin, Marios hingegen wird als Unfallopfer in den Wirren der Demo in die Arbeitsunfähigkeit gedrückt. Krankenversicherung, soziales Auffangnetz, Kostenübernahme Fehlanzeige. Der Ernst der finanziellen Notlage eines hochverschuldeten Landes drückt sich durch die Erzählung aus, durch die Cornelia aus Beobachterin gleitet, und verdichtet sich zum Ende hin, als die eigene Odyssee ausgelaufen ist. Ich bemühe mich, an ein Wunder zu glauben, aber das wird manchmal sehr schwer, reüssiert Cornelia, die den gesamten Roman hindurch als mundartige Ich-Erzählerin ihre Abenteuer rückblickend zu relativieren versucht. So drastisch, so gefährlich, so ernst wären die Situationen ja wohl eh nie gewesen, aber sie habe aus plötzlicher Angst überreagiert oder ihrem Bauchgefühl einen Vorzug gegeben.
Das ist die Story. So richtig interessant aber wird die schwummrige Abenteuerfahrt erst, wenn über den reinen Text hinausgeblickt wird. Am Cover des Romans heißt es nämlich: Marlene Streeruwitz als Nelia Fehn. Wer sich hiervon nicht irritiert fühlt, übersieht ein literaturproduktionstechnisch bedeutendes Detail in der Genese des Romans: Nelia Fehn ist nämlich selbst eine Romanfigur, die in Marlene Streeruwitz' „Nachkommen“ mit ihrem Erstlingswerk auf die Frankfurter Literaturmesse geschickt wird. Als Aufdeckerroman, als Abgesang auf den gegenwärtigen Literaturbetrieb angelegt, ist „Nachkommen“ im für Streeruwitz typisch knappen Stakkatostil geschrieben. Für „Die Reise einer jungen Anarchistin in Griechenland“ tauscht Marlene Streeruwitz aber nicht nur den Namen, auch der Stil des Romans wird zum plappernden, direkt-naiven Erzählwerk der Nelia Fehn. Alles nur Show?
Marlene Streeruwitz hat Humor, das muss man ihr lassen. Wie sonst lässt sich dieser Metaroman erklären, der zwischen ihrer Autorinnenschaft und der Autorinnenschaft ihrer eigenen Romanfigur angesiedelt eine Geschichte erzählt, die für sich selbst stehen kann und gleichzeitig ja doch eine Schreibübung ist? Spaß macht die Lektüre trotzdem, wenn Cornelia von einer verhinderten Weiterfahrt in die nächste gerät und nebenbei die Geschichten ihrer Mitreisenden und kurzfristigen Begleiterinnen als Psychogramme einer dysfunktionalen Gesellschaft skizziert. Denn das gelingt der Erzählerin in gewohnter Beobachtungsgabe – wohlgemerkt – in von der Autorin hinter der Autorin gewohnt. Marlene Streeruwitz lässt sich nicht aus diesem Romanexperiment hinausleugnen und das ist auch wunderbar so.
iris gassenbauer |
|

|
_______________________________
August 2025
|
|
|
Teresa Präauer: Kochen im falschen Jahrhundert. Wallstein 2023
Ein Kammerspiel in vier Akten. Eine geschlossene Gesellschaft mit Wiesenblumen am Designertisch. Ein Roman, der hungrig macht. Mit „Kochen im falschen Jahrhundert“ kreiert Teresa Präauer ein überwürztes und gleichzeitig wohlig füllendes literarisches Gericht, das sich durch Situationskomik ebenso auszeichnet, wie durch einen Blick, der auch tief vergrabene soziale Dynamik offenlegt.
Die Ausgangslage ist vertraut: ein junges Paar lädt auf Initiative der Gastgeberin hin Freund*innen zum Abendessen in kleiner Runde ein. Der Ausgang? Nun, das hängt davon ab, welcher Erzählstrang zu Ende gedacht werden soll. Denn Therese Präauer lässt die Ausgangslage gleich mehrfach anlaufen und entspinnt so gleich mehrere mögliche Szenarien, die alle früher oder später am gemeinsamen Tisch enden. Dazwischen schwebt das Ungewisse der kleinen Gesellschaft und der möglichen Kurven, Sackgassen und Kehrtwenden, die sich im Laufe des kulinarischen Miteinanders ergeben.
Das Figurenset bleibt gleich, variiert nur in seiner An- bzw. Abwesenheit. Die Gastgeberin als Fixstern der Erzählung, zwar schon vor längerer Zeit in die großzügige Wohnung übersiedelt und von der Idee angetrieben, im Kochbuchidyll auch Freund*innen zum gemütlich-köstlichen Abendessen ins Heim zu laden, übersieht die noch immer unausgeräumten Bananenkisten, die fehlenden Sitzmöglichkeiten und auch die schwindende Motivation, sobald die Einladung einmal ausgesprochen ist. Glänzen möchte sie, so wie die Hochglanzseiten der Weltkulinarik der gedachten Bilder, und zwischen Crackern und Salznüssen, leichtem Sommersalat und Quiche, zwischen Crémant und Schnapserl als versierte und charmante Moderatorin des Abends auftreten.
Dann aber hat das geladene Ehepaar schon gegessen, kommt der Schweizergast zu spät, raucht am Balkon und verliert die brennende Zigarette auf dem gebohnerten Parkett, woraufhin der Partner der Gastgeberin ausgerechnet das liebgewonnene dänische Geschirrtuch als Löschdecke missbraucht. Dann wird jeder Satz der Gastgeberin zwischen den Sätzen der anderen zu einer Schmeißfliege, ja, dreht sich jede Aussage wie ein kleiner Kosmos nur um die eigene Achse, ohne eigentlich wahrgenommen zu werden. Dann kommen die Gäste durch den Regen und man lässt die Schuhe an. Der stumme Fingerzeig der Gastgeberin auf die nassen Sohlen blieb verborgen (S. 99) und die Ehefrau stakste in ihren Stilettos, die das Potenzial besaßen, Parkettböden zu schädigen (S. 102), durch den bananenkistenverstellten Raum. Dann futtert der Partner die Cracker weg, bevor die Gäste denn überhaupt erst eingetroffen sind, und als es kommt, dreht sich beim Ehepaar alles nur um den erst zuvor bei den Großeltern abgeladenen Säugling.
Alles, während im Hintergrund ausgesuchter Jazz von der Zufallsauswahl des Algorithmus bestimmt wird; Schließlich soll auch die Hintergrundmusik intellektuell feingetuned sein.
Zwischendurch werden die Karten dann wieder neu gemischt und der Abend auf Null gestellt.
So etwa hätte der Abend beginnen können (S. 81), leitet ein neues Kapitel ein, nachdem zuvor der im Tiefkühler vergessene Crémant de Limoux explodiert war, zu Schaum gefroren, teils weiterhin in der Flasche, teils sich bereits aus der Flasche heraus ins Fach vergossen habend […] (S. 73 f.). Und schon sind Gastgeberin und Partner alleine, warten auf die verspäteten Gäste, die nicht und nicht an der Tür klingeln wollen, also Zeit genug lassend für ein kurzes Erinnern an die Möglichkeit eines erotischen Abenteuers, das in einer linkischen Verunfallung des Partners endet und dem schließlichen Eintreffen der Gäste, die illuminiert und gesättigt direkt aus einer Bar eintreffen. Dort hatten sie Amerikaner*innen kennengelernt, die später auch noch aufschlagen werden, nachdem die Ehefrau das Zusammenkommen gefällig gefiltert und mit reichlichen Tags versehen in Social Media teilt. Später trinkt man sich in die Versöhnung, wird von der Polizei aus dem Dussel geläutet und dämmert schließlich mit dem Morgen in den neuen Tag.
Weshalb der Roman zu einem Festmahl wird und nicht zu einer schnellen Junkfoodpartie lässt sich der Beobachtungsgabe der Autorin ebenso begründen wie in der Struktur der Narration, die sich in ewigen Schlingen durch das Mögliche legt. Nach dem Gastmahl ist zugleich davor. Dazwischen stehen die kulinarischen Erinnerungen einer Erzählfigur an ein gedachtes „Du“ und das Speisenrichten der Gastgeberin mit all seinen kleineren und größeren Abweichungen. Sie werkt zwischen Vinaigrette, für die sie Weißweinessig mit Olivenöl vermengt, Romana, Rucola und Eichblattsalat mischt, Kirschtomaten halbiert und roten Paprika mit Frühlingszwiebel würfelt. Sie
[…] gab scharfen Senf dazu und einen Teelöffel Honig, außerdem Salz und Pfeffer. Sie hackte frische Kräuter, Petersilie, Schnittlauch und Basilikum, und hob sie unter. Mit einer Flasche Crémant auf dem Küchentisch machte das Kochen ja beinahe wieder Spaß. (S. 114)
Die Kapitelüberschriften setzen sich aus den reduzierten Rezeptangaben für das Folgende zusammen, aus 4cl Rum, 4cl Sodawasser, 3 Teelöffel weißer Zucker, 1 Limette, Minzblätter, Eiswürfel (S. 24) aus 1 Leberkässemmel, 1 Qualitätszeitung von gestern (S. 160) oder schlichtweg zu viel Senf (S.143).
Versalzen wird die Story dabei nicht; sie bleibt ein köstlicher Gesellschaftsroman, ein unterhaltsamer Schinken, der nicht im Bauch liegt, ein, um bei weiterer aufgelegter Metaphorik zu bleiben, vollmundiger Qualitätssprudel, der jeden bitteren Nachgeschmack so lange zu kaschieren weiß, wie der Rausch andauert.
Iris gassenbauer
iris gassenbauer |
|
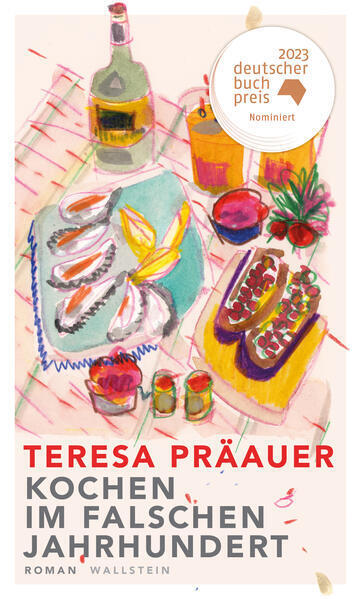
|
_______________________________
Juli 2025
|
|
|
Andrea Heinisch: Gute Kinder, Picus 2024
Nur ein kleiner Ausflug, sage ich und nicke im Vorbeigehen der Frau an der Rezeption einen Gruß zu, freundlich wie immer, doch sie ruft mir nach: Ja Frau Heiligstetter, Sie können doch nicht alleine losgehen!
(S.64)
Nur ein kleiner Ausflug – was hier so selbstverständlich aus dem Mund der Erzählerin kommt, läuft schnell an Schranken. Denn weder ist die Erzählerin Gast in einem Hotel, noch kann sie ihre Tagesstrukturen nach Belieben selbst gestalten. Tatsächlich ist die siebzigjährige Inge dort, wo man das Vorher an der Tür abgibt wie altes Gewand, das einem beim besten Willen nicht mehr passt und nie wieder passen wird. (S. 7) In einem Pflegeheim, dauerumsorgt vom Personal. Dazu kam es, weil sie ihre Wohnung in Brand gesetzt hatte und die Tochter, von der Situation überfordert, die Mutter neu unterbringen musste. Inge, die sich in ihrer neuen Umgebung nur unwillig einfügt, findet im Pfleger Manni eine Person, der sie ihre Erinnerungen anzuvertrauen bereit ist, begegnet den anderen aber mit der Skepsis der Inhaftierten. Gleichzeitig verrutscht ihre Wahrnehmung mehr und mehr. Gesichter und Erlebnisse gehen verloren, werden überlagert von biografischen Skizzen und Gefühlsblitzern, bis es zwischen der Gegenwart ihrer Umgebung und dem Vorher ihrer Gedanken kaum mehr Anhaltspunkte der Unterscheidung gibt.
Die Ich-Erzählerin wird dabei zur unsteten Komplizin der Leser*innen, lässt einblicken in die wahren Motivationen für ihr Handeln – oder zumindest in das, was sie zu dem Zeitpunkt für real hält. Dadurch entsteht ein vielschichtiges Nebeneinander der Narration; Sprunghaft changieren die Schilderungen, die im eindringlichen Präsens gehalten sind, zwischen Wahrnehmung und Erinnerung. Der selige Ehemann Herbert überlagert so Pfleger Manni, die vielen Besuche der Tochter Helene versickern spurlos, kleinere und größere Themen schlittern als seltsame Psychosen durch ihr Empfinden und gelegentlich pocht sie die Grenzen ihrer neuen Lebensrealität gehörig ab:
Den Kopf, den Schädel, um den Schädel geht es, haben sie mir fixiert. In eine Box gesteckt und fixiert. Ich habe nachgegeben, aber zuschauen werde ich ihnen nicht auch noch. Ich schließe die Augen. Am liebsten gleich für die Ewigkeit, denke ich, und bin froh, dass sie mir Kopfhörer aufgesetzt haben. Trommler, Pfeifer und Gaukelspieler müssen draußen bleiben. Die Ewigkeit ist still. Manfred hat mir seine Hand auf die Beine gelegt, alles andre von mir ist ja Maschine. Manchmal drückt er wie zur Bekräftigung […] Als ich aus der Maschine gezogen werde, stelle ich mich eine Zeitlang tot. Vielleicht verwirrt sie das. Mich zumindest verwirrt es, ich muss lange nachdenken, bis mir wieder einfällt, dass ich am Leben bin. Kann man sterben, wenn man vergisst, dass man in Wirklichkeit lebt? Ich glaube ja. Das ist alles eine Frage des Willens.
(S. 89f.)
Andrea Heinisch gelingt die Darstellung einer Ich-Erzählerin, die gleichermaßen unzuverlässig wie nachvollziehbar ist, durch deren Narration die Erinnerung an das Vorher in einer unzufriedenstellenden Ehe, Mutterschaft und Arbeit im Import-Export tröpfelt und die Gegenwart einfärbt. Es sind bittere Rückblicke, aber nicht weniger scharf; Die Kritik am Leben davor kommt en passant. Gleichzeitig ist Inges Haltung durch einen tiefen Widerwillen geprägt, nach den Spielregeln des Pflegeheims zu spielen. Zwischen Senilität, Demenz und mildem Ungehorsam stiftet sie sich selbst und etwa auch die Heimbekanntschaft Dorothea dazu an, Grenzen auszureizen, und wird dadurch zu einer tragisch-komischen Figur. Am Schluss bleibt die Frage nach dem Wesentlichen, dem Fassbaren, das nicht verloren gehen kann. Es findet sich im Detail und in den Beziehungen, die das Leben gesponnen hat, wenn der Rest auch früher oder später verloren geht.
Zugriff jetzt, denke ich. Und doch werdet ihr alle, ihr alle werdet den Zugriff verlieren. Eintauchen werde ich in den letzten Moment wie ins Meer in Istanbul. Zu weit hinausschwimmen werde ich, zu tief tauchen werde ich, hinter mir werde ich alles lassen, das war, nichts werde ich wissen von dem, was kommt.
(S.190)
iris gassenbauer |
|
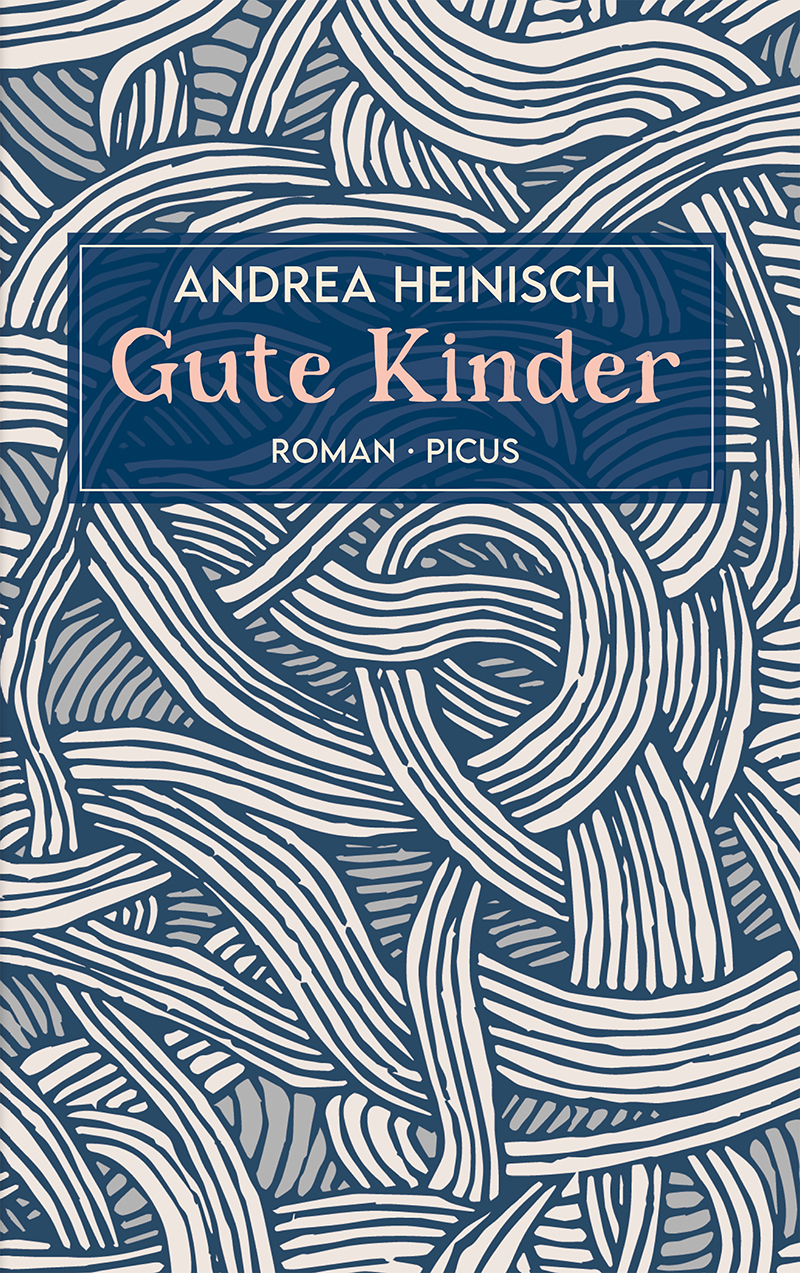
|
_______________________________
Juni 2025
|
|
|
Barbi Marković: „Piksi-Buch", Voland & Quist, 2024
Eine Welle geht durch das Stadion, kollektiv wird von der Tribüne geblökt, wenn auf der anderen Seite das bengalische Feuer den Stadionhimmel durchfaucht. Und am Spielfeld fliegen sie dahin, die einen gegen die anderen zehn, hin und wieder rollt einer durch den kurzen Rasen, dann wieder duellieren sich zwei, ein Tritt, ein Zischen, ein Gegen-die-Stange-Schnalzen oder rein ins Netz. Danach wird gefeiert oder brennende Tränen werden nicht hinuntergeschluckt, es wird auf die Spieler geschimpft oder auf das „Wir“ mit Dosenbier angestoßen. Alles nur Klischees, diese Fußballszenarien? Ein bisschen, zugegeben. Aber um durch die Klischees zu tauchen und Fußball auf eine Art und Weise erzählt zu bekommen, wie sie auch den Unsportlichsten und Mannschaftsdesinteressiertesten unter die Haut geht, empfiehlt es sich, Barbi Marković zu lesen.
Die Erzählerin spricht mit uns, direkt und im Plauderton einer Rückschau. Sie heißt uns willkommen im Stadion des Belgrader Akademischen Sportklubs (BASK), wo sie, Barbi Marković, gerade achtjährig geworden, ihren Geburtstag (schon wieder) verbringen muss.
Ich sitze auf den Tribünen und schau dem Rasengeschehen nicht zu. Mit einem durchnässten Taschentuch versuche ich, meine Gräserallergie aufzufangen, bevor die Welt zerfällt und alles im Rotz versinkt. An diesem Tag ist mein achter Geburtstag. Ein Mann hat gerade schlimme Sachen über die Mutter des Schiedsrichters geschrien.
(S. 9)
So vieles öffnet sich in diesen einführenden Worten, was für „Piksi Buch“ programmatisch ist: Hier sitzt die kindliche Autofiktion der in Belgrad geborenen Autorin, alternativlos und im Umwelt grobschlächtiger Sportbegeisterung, alleine, obwohl der Vater sie genau dort sehen will: als großes Sportskind, wie es die Buben sind, die ihren Papas nacheifern. Aber Barbi interessiert sich nicht für das Runde und das Eckige, tut nur gutmütig mit, weil es auch sonst nichts zu tun gibt für sie. Und dann der Vater: Slobodan Marković ist entweder im Sport oder abwesend, blüht auf, wenn der Ball springt und wenn es um die Spieler geht und verschwindet dazwischen aus dem Sichtfeld der Tochter, vergisst sie im Stadion, weil er plötzlich weg muss, um Geschäfte abzuschließen, vergisst später, dass er überhaupt Vater zur Familie ist oder verdrängt es zumindest in dieser Zeit des Brodelns. Heiß ist es, staubig und trocken. Essen ist knapp, eine Gereiztheit liegt auf den Gemütern, ein gespanntes Brodeln, das sich (noch) in Fanbrutalität entlädt. Die Erzählerin beobachtet die Männer, wie sie spielen und wie sie über das Spiel hinaus ihre Regeln der Stärken fortspinnen.
Wenn man lange genug in das Abseits starrt, blickt das Abseits zurück. Wenn man lange genug den Stadionstammgästen ausgeliefert ist, verliert man den Verstand. Sie sind machtlose Charaktere, Alkoholiker, aber sehr gemein. Sie wissen immer, wie sie dich in die Knie zwingen können, wo es wehtut, da stechen sie hinein. Und wenn es gerade niemanden zum Stechen gibt, machen sie so einen Unsinn. Rufen „Abseits“. (S.19)
Die Kleinen skandieren den Großen nach und beten die Spielernamen auch im Schlaf als Mantra der Zugehörigkeit herunter, die Großen raufen sich, schmeißen Gegner über die Balustrade der Tribüne, veranstalten im Maksimir ein gemetzeltes Durcheinander das kein Spiel mehr zulässt. Kräfte und Zugehörigkeiten werden gegeneinander gedrückt, bis Knochen knacken, zuerst aber noch nur am Feld.
In diesem Nochspiel und Dochschonernst am Abend vor dem Krieg parodiert sich die Erzählerin nicht nur durch das, was im Stadion passiert, sondern auch durch ein an mehreren Stellen arg poröses Vater-Tochter-Gewächs. Er spricht von ihr als er, denn [e]s ist unvorteilhaft, eine Tochter zu haben, aber es ist auch unvorteilhaft, eine Tochter zu sein. (S. 20).
Er kommt mit verranztem Frischkäse und einer Tube Zahnpasta angetingelt, als sie wieder einmal auf brauchbare Geburtstagsgeschenke, sozioökonomische Unterstützung und Companionship (S.43) hofft, aber der Zug ist längst abgefahren. Der Vater will, dass sie zwischen ihm und der Mutter vermittelt, die Erzählerin will als Tochter wahrgenommen werden, was die Mutter will, erfahren wir Leser*innen nicht, denn Mütter und Frauen im Allgemeinen sind im Buch ebenso konsequent abwesend, wie der Titelgeber Piski aka Dragan Stojković, Piksi mit den Wunderfüßen, der den Zauberstaub aufwirbelt. Der Staub, der das Mädchen zum Fußballspieler machen soll und den Slobodan Marković als Zeichen seiner Liebe dem windigen Bekannten abkauft, um Barbi damit zu bestäuben.
Magisch ist dieses Element und abgedreht seltsam, so wie es auch Slobodan Marković ist, wie es überhaupt die ganze Erzählung ist, sie sich zwischendurch selbst überholt und von außen betrachtet:
Schön. Schöne Hintergrundinformationen. Schon wirkt die Geschichte frischer. Barbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Barbi Marković, das ist ja unglaublich, im ersten Kapitel, in der 6. Leseminute so ein Treffer. Keine hat so viel gemacht. Meine Güte. Klasse geschrieben. Wie schön ist das denn?! Barbi Marković, eiskalt. Die Einzige, die über Fußball anders erzählt. Sensationell. (S. 14)
Oder später im zweiten Teil des Büchleins, in dem das Spiel Argentinien gegen Jugoslawien in Florenz schrittgenau geschildert wird:
Während der Kollege sich regeneriert, kann ich Sie, eine Leser:innen, über unsere Situation im Wohnzimmer kurz updaten. Slobodan Marković hofft sehr, dass Jugoslawien gewinnt und dass es zu keinem Krieg kommt. (S. 87).
Der Krieg aber wird kommen. Ob Jugoslawien gegen Argentinien im Elferschießen gewonnen hätte oder nicht. Barbi Marković lässt die Vorstimmung auf die kommende Katastrophe heraufdämmern, ohne ihr direkt ins Gesicht zu blicken. Mehr aber lauert sie im Hintergrund eines Textes, der alles verstanden hat: so zu erzählen, dass ein Weglegen des Buches nur in der Halbzeit möglich ist (wenn überhaupt); eine Gesellschaft aus den Augen einer autofiktionalen Jungprotagonistin zu schildern, die zum Glück nicht altklug, sondern kindklug daherkommt; die wenigen Charaktere in ihrer Verdrehtheit greifbar und rillig zu machen und immer ein wenig zwischen dem Wahrscheinlichen und dem Tatsächlichen zu springen. Der Krieg bleibt außen vor, bis er auf einmal da ist.
Angekündigt hat er sich längst; in den durstigen Männer- und Knabenchören der Tribünen, in den ausgetrockneten Stadionböden, in der Aufgeregtheit der Fußballreporter und den Anbetungen martialischer (Fußball)helden, die für Kraft und Sieg stehen sollen. So kommentiert die Erzählerin für uns Lesende das Vorabendspiel des Zerfalls der Neunzigerjahre im nur scheinbaren Plauderton, nur scheinbar aus der Leichtgängigkeit der Acht-, Neun-, Zehnjährigen.
Am Schluss werden alle weinen.
iris gassenbauer |
|

|
_______________________________
Mai 2025
|
|
|
Ljuba Arnautović: Erste Töchter, Zsolnay 2024
P. S.
Manchmal frage ich mich, wie wir geworden wären, wären wir zusammen geblieben. Und ob es einen Unterschied gemacht hätte, ob das in Wien oder in München gewesen wäre. Ich kann es mir einfach nicht ausmalen. Du bist einfach DU, und ich bin ich.
(S. 112)
Wien oder München – das ist nur eine Rochade-Option in Ljuba Arnautović autofiktionalem Roman „Erste Töchter“, der gleichzeitig auch den dritten Teil ihrer Wurzelaufarbeitung darstellt. Die Frage könnte nämlich auch heißen: Wien oder München oder Moskau. Oder: Mama oder Mutti oder Oma oder Dörte. Oder: Tischordnung oder RAF. Altbauwohnung oder WG-Zimmer. Tanzschule oder Klassenkampf. Russisch oder Deutsch. Schwestern oder Fremde.
Es ist eine Erzählung aus der Distanz, ein meditatives Dahineilen der Tatsachen, die Ljuba Arnautović ohne Pomp und Glorie geradezu auflistet. Da ist zu Beginn das Frühjahr 1934, als Karl und Slavko, beides noch Buben, über die tschechische Grenze geschleust werden, weil die Eltern politisch verfolgt sind. Eingemischt haben sich der Vater und die Mutter, angeschlossen haben sie sich dem „Republikanischen Schutzbund“, aber 1933 ist die Kommunistische Partei verboten worden und zu Jahresbeginn 1934 trifft es auch die sozialdemokratische Arbeiter-Zeitung. Die Kinder müssen also weg, auf die Krim und die Eltern sollen Karl erst wieder nach 22 Jahren in Wien begrüßen können. Das, was in gleich mehreren Romanen Platz gefunden hätte, wird hier in geschmälte Zeilen gepackt – ebenso, wie die weitere Geschichte, die Karl und seinen Werdegang zwischen Erziehungsheim und Selfmademan, Opportunist, Egomane und angeblichem Spion nachzeichnet. Karl, das ist außerdem der Vater der beiden Töchter, von Luna und Lara, wobei Luna, die erste Tochter, auch gleichzeitig in den autofiktionalen Fußspuren der Autorin wandelt. Schließlich ist es ihre Geschichte, die erzählt wird, und nicht die von Karl, den Ljuba Arnautović schon in Junischnee (2021) in all seiner menschlichen Monstrosität skizzierte. So lernen wir hier das Durcheinander der Nachkriegsjahre kennen, das das Aufwachsen der Schwestern zwischen den Stühlen bedingt, zwischen der Mama (der leiblichen) und der Mutti (der kurzfristigen Partnerin), zwischen Wien, wo die Frauen wohnen, und München, wo der erhoffte Aufstieg daheim ist und im Altbau mit Studentinenehefrau wartet, mit neuen Zwillingen, die wieder keine Buben sind, und Geschäftsmodellen, die Geld bringen.
Die Erzählperspektive ist, auch wenn es nahegelegen wäre, nicht in Ich-Position gehalten, sondern in einem distanzierten auktorialen Blick, der zwischen den Zeiten springt und mal hier die Zügel anzieht, während er dort zum Galopp treibt. So werden die Nachkriegsjahre locker entrollt und die Eckpunkte nur nebenbei markiert: das mehrmalige Abschieben der Mädchen ins Heim, das Aufteilen zwischen München und Wien, das Zusammenfinden und wieder Auseinandernehmen mühsam gewachsener Strukturen. Alles durchwirkt von stets pikant gewählten Manipulationen Karls, der sich trittssicher durch sein eigenes Schicksal laviert.
„Die Mutti will euch nicht mehr in Wien haben. Sie hat jetzt wahrscheinlich einen neuen Mann.“ Zu Erika sagt er: „Die Kinder möchten lieber hier bei mir bleiben. Mach es ihnen nicht unnötig schwer. Und schreib ihnen nicht. Wenn doch, werden sie deine Briefe nicht bekommen.“
(S. 47)
Irgendwann nimmt der Einfluss des Vaters ab und die Töchter erkennen, dass sie sich freisagen können von den verstreuten Elternteilen, den sehnenden Mutterfiguren in ihren überfordernden Lebenssituationen und den Strukturen, die ihnen wechselnde Behörden und politische Zeitalter auferlegen. Die Mädchen rütteln an ihren Verhaftungen, bis diese teilweise nachgeben oder noch mehr verhärten; ein Kräftemessen mit nur scheinbar vorgetrampelten Lebenswegen. Im Mittelpunkt des erzählerischen Rauschens bleibt aber ungetrübt das Entfremden und Annähern der Schwestern, das Zeitenübersetzende Abgleichen und Inverbindungsetzen, das bis zum Schluss nicht abreißen soll.
Dazwischen geschieht das Leben der Jahre danach, der Jahre des Aufbaus und des Wirtschaftswunders, der 68er und des Kalten Kriegs, geschildert in der knappen Sprachschönheit, die Ljuba Arnautović hier perfektioniert hat:
Die Schlafwagenschaffner sind die Herbergseltern, sie verteilen Bettwäsche und Handtücher. Die Fahrgäste beziehen ihre Betten selbst, ohne Klassenunterschied. Aber natürlich gibt es den […] Die ersten Pass- und Zollformalitäten werden abgewickelt. Draußen ist jetzt die Slowakei, hier drinnen geht der Nestbau weiter. Der Zug hält oft, wechselt jedes Mal die Fahrtrichtung. Mitternacht ist längst vorbei, bis er einen ruhigen Puls findet auf seinem Weg durch die Tatra. Zwei Meter lang, zwei Meter breit, das wird Lunas Zuhause für die kommenden Stunden sein. Eine Nacht und einen Tag und noch eine Nacht wird sie hier essen und trinken, lesen, stricken, sich langweilen oder mit den Nachbarn Karten spielen. Hier wird sie sich waschen, die Zähne putzen und sich ein Nachthemd anziehen. Die Stunden im Schlaf dürfen ungezählt bleiben.
(S.134)
Ist es notwendig, Teil eins und zwei der Trilogie zu kennen, um „Erste Töchter“ verstehen und mit Genuss lesen zu können? Ganz und gar nicht. Der Roman steht für sich selbst, nimmt sanft an der Hand und zeigt auf die Dinge, ohne sie zu Ende zu erklären. Er ist nicht geschwätzig, nicht detailverliebt, nicht sensationsgierig oder pathetisch. Er erzählt, ohne nach Aufmerksamkeit zu haschen, und im besten Fall spenden wir diese freiwillig und mit großer Freude an einem dichten und zugleich so wunderbar luftigen Textgeflecht, wie es Ljuba Arnautović mit „Erste Töchter“ zu Papier brachte.
iris gassenbauer |
|
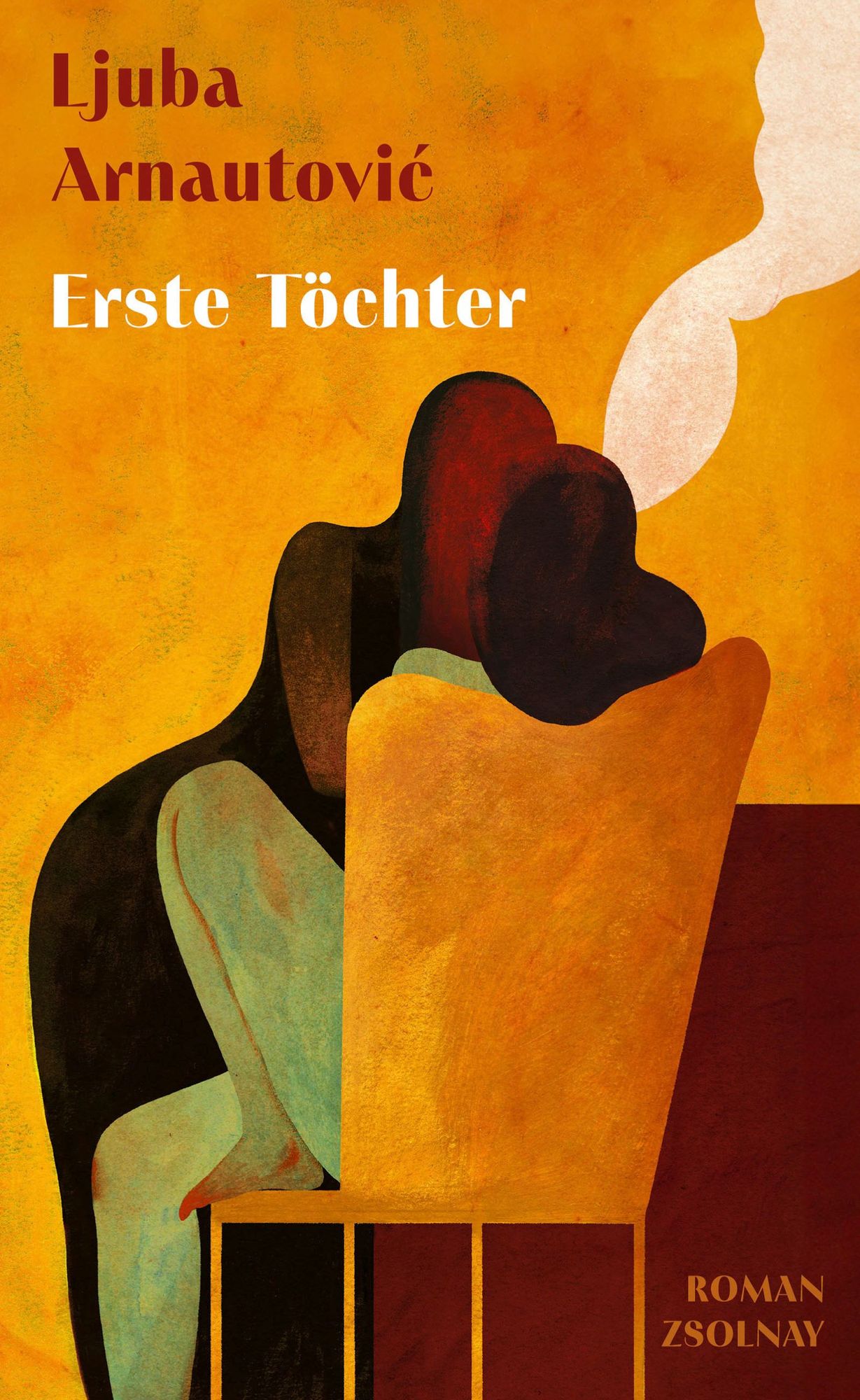
|
_______________________________
April 2025
|
|
|
Markus Köhle: Land der Zäune. Sonderzahl 2025
IAchtung, das ist eine Warnung: dieses Buch wird Sie grantig machen. Der Protagonist Hans Sagmeister wird Sie nach anfänglich höflichem Interesse Ihrerseits früher oder später (je nach Ihrem Toleranzlevel) dazu bringen, die Augen zu rollen, die Zähne zu knirschen und den Kopf zu schütteln. Er wird Ihnen mit seiner Affinität zu Zäunen, zu Absperrungen, Grenzziehungen und zum Verbalstopp „Nein!“ auf die Nerven gehen, wird Sie mit seinen imaginierten (Wut-)Tiraden zur Weißglut bringen und wird Ihnen mit seinem ambitionierten Vorhaben, eine eigene Partei für Gleichgesinnte zu gründen, ein abfälliges Schnauben nach dem anderen entlocken. Und hoffentlich sind keine Katzenliebhaber*innen unter Ihnen, sonst landet die Lektüre ab Seite 52 mit einem gezielten Handkantenschlag womöglich in der nächsten Ecke Ihres Lesezimmers.
Aber so schlimm wird es doch schon nicht werden, denken sich nun vielleicht einige von Ihnen. Es gibt ja auch noch andere Figuren im Roman; da wird doch wer gegenhalten! Nun, die Nebenfiguren machen das Kraut an Sympathieträger*innen und innerliterarischem Anknüpfungspotential auch nicht fett. Nicht der Neo-Nachbar Marlon mit seiner verduselten Liebe zu seinen beiden Stubentigern und zum Sprachspiel mit Fremdschämpotential, nicht die Entsorgerin, die als Mischwesen aus Therapeutin und Chat-Bot den Grillen Hans Sagmeisters eine geduldige Bühne bietet und ganz bestimmt nicht Romähn, der Mähroboter. Am ehesten vielleicht noch Hans‘ Mutter, die den Sohn durch verbale Boshaftigkeiten schikaniert und strenggenommen wahrscheinlich eine der Hauptverantwortlichen für die Zaunbegeisterung des Sohnes Hans Sargmeister ist.
Warum also solle man sich die Lektüre dann überhaupt zumuten? Nicht, um den eignen Blutdruck zu befördern. Aber vielleicht, um das Psychogramm eines Menschen vorgezeichnet zu bekommen, der sich aus der Exklusivität der Stammtisch-Polterer herausgeschält hat und nun durch die auktoriale Erzählstimme vor unseren Augen zerlegt wird: durch den Import und Verkauf kurzlebiger Trendprodukte zu Wohlstand gelangt, bezieht Hans Sagmeister in Unterbrombachkirchen ein Haus in einem stereotypen ruralen Niederösterreichischem Kaff und versucht von dort aus, seine Weltordnung, in der alles geregelt, strukturiert und vor allem in klaren Grenzen verläuft, zur allgemeinen Anwendung zu bringen. Das Mittel zum Zweck: der Zaun.
Ich habe meine Leitlinie gefunden. Es war der vermeintlich christliche Kanzler, der mich auf die Idee mit dem Zaun brachte. Der Kanzler sprach davon, dass Zäune und Mauern kein Tabu mehr sein dürften. Tabus sollte es überhaupt keine mehr geben im 21. Jahrhundert. Es muss alles geben dürfen, selbstverständlich auch Zäune und Mauern. Mein Zaun gibt mir Halt und Einhalt. Mit Menschen habe ich gewisse Probleme. Mein Zaun macht keine Probleme. Mein Zaun löst Probleme. Ich kann meinen Zaun nur in den höchsten Tönen loben. Ich kann dir auch Zaun sein, antwortete die Entsorgerin. Das gefiel Hans natürlich. Das brachte sie ihm deutlich näher. S. 31
Das Eigene und das Fremde solcherart klar von einander abtrennend und Sicherheit, Stabilität und Beständigkeit im Ausschluss der Anderen zu findend, möchte Hans Sagmeister von Unterbrombachkirchen aus mit seiner neu gegründeten Partei, der ZPÖ (Zaun-Partei-Österreich) als selbsternannter Zaunkönig und Zaunkanzler ins Parlament einziehe. Das Programm: Sicherheit schaffen!
Denn das Bild „alte Gräben zuschütten“ muss endlich die positive Färbung verlieren. Wenn offensichtlich ein Spalt durch die Gesellschaft geht und wir das auch anerkennen, können wir diesen Spalt entweder untergraben oder schön ordentlich mit Zäunen und Mauern absichern. Hans hat nichts dagegen, alte Gräben zuzuschütten und neue, zeitgenmäße, besser befestigte aufzumachen. (S. 181.)
So abgedreht sich dieser Hans Sagmeister auch in seine Zaunfantasien versteigt, über Poller und Vollpfosten in Lobenshymnen ausbricht und seine Zukunftsvisionen als Zaunkanzler der Nation ausbuchstabiert, so fabelhaft gelingt Markus Köhle in seinem Roman ein in vielen Aspekten gruselig aktueller Gesellschaftsblick. Es ist die (überzeichnete?) Rhetorik einiger politischer Zeitgenoss*innen, die hier geradezu beklemmend eindrücklich in Hans Sagmeister zusammensiedet, es ist der Zeitgeist der Grenzabsicherung, Abgrenzung und Aufrüstung gegen "die Anderen", die "Land der Zäune" zu einem wichtigen Gegenwartsprotokoll machen. So ist der Roman ein Warnschuss, der uns Leser*innen mit einer Frage im Kopf den Blick in unsere Umgebung schweifen lässt: wer würde hier wohl Hans Sagmeisters Zaunpartei wählen?
Wir sind die ZPÖ! Was vor unserer Haustür passiert, interessiert uns nur, wenn es unsere Freiheit einschränkt. Einschränken lassen wir uns von niemanden. Das machen wir schon selbst. (S. 193)
iris gassenbauer |
|

|
_______________________________
März 2025
|
|
|
Irmgard Kramer: Hilda. Meine Großmutter, der Nationalsozialismus und ich. Falterverlag 2023.
Irmgard Kramer erhält inmitten des Covid-Lockdowns einen Anruf vom Stadtmuseum Dornbirn, ob sie interessiert daran wäre, über die Menschen Dornbirns zu schreiben, die im Nationalsozialismus gequält, vertrieben, ermordet wurden; über diejenigen also, deren Namen auf den Gedenksteinen festgehalten wurden. Und während dieser Phase des coronösen Stillstandes nimmt Irmgard Kramer an:
Ich will wissen, wie es war im nationalsozialistischen Dornbirn, und freiwillig würde ich mich jetzt nicht mit diesem Thema befassen. Wer liest schon gern über all die Gräuel bis hin zur Ermordung behinderter Kinder? Ich habe Angst vor dem, was mir auf meiner Zeitreise begegnen wird. Wird mein liebgewonnenes Bild von meiner Heimatstadt zerstört werden? Wohl kaum.
In Dornbirn, so die Annahme der Autorin, die noch am Anfang ihrer Recherche steht, sei es doch nicht so schlimm gewesen. Lauter Dornbirn sei ja nicht Berlin gewesen. Oder Wien.
Mit dieser Hoffnung im Gepäck macht sich Irmgard Kramer nach Dornbirn auf, nur um bald an den eigenen Überzeugungen zu zweifeln. Hier tun sich nämlich plötzlich Abgründe auf, die nicht ins Bild der Erinnerung passen, die gewaltig am Erbe der Vergangenheit kratzen.
Irmgard Kramer aber holt tief Luft und taucht durch die dunkelbraune Geschichte, arbeitet sich an Personen, Erinnerungen und Ereignissen ab, die in dieser Form bis dahin nicht im kollektiven Gedächtnis verankert waren, forscht, dringt tiefer und stößt immer und immer wieder auf schmerzhafte Stacheln der Vergangenheit, die tief im Fleisch stecken bleiben.
Zum Sinnbild der Kluft zwischen persönlichem Erinnern, Verschweigen, Vergraben und neu Ausbuddeln wird aber nicht der Salzburger Nazi-Großvater Leopold und seiner Wagenladung an geistigem und materiellem Erbe, mit dem die Familie nach seinem Tod zu kämpfen hatte.
Sein Nachlass hat schon rein kubikmetermäßig ein beängstigendes Ausmaß. Seine Gemälde hängen in unseren Wohnungen. Sein Schmuck ziert unsere Finger. Mit seinen Nazi-Devotionalien aus kiloschweren Bronzestatuen samt Hakenkreuzen und allem Pipapo könnten wir im Darknet auf Neonazi-Foren ein Vermögen machen […] (S. 13)
Nein, es ist die Dornbirnerin Hilda, die schwerhörige und stille Großmutter der Autorin, in der das vielschichtige Erinnern und Zusammensetzen der Vergangenheit zusammenläuft. Denn Hilda, die brave Oma und deren Mann, der doch bestimmt unpolitische Möbelbauer, zeigen sich in der Recherche als vielschichtiger, als es die Autorin jemals erwartet hätte. Und mit der Erkenntnis, dass nicht die gedachten (oder gehofften?) Erinnerungen beständig bleiben, sondern ein Spektralfarbenbogen der Ambiguität aus der Familiengeschichte erwächst, folgt Irmgard Kramer den Spuren, die Hilda und die anderen Bewohner*innen Dornbirns in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges hinterlassen haben.
Was aus dem Spurenlesen wird, ist ein szenisches Hinein- und Hinausblenden in Leben und Erlebnisse, die Irmgard Kramer aus der Geschichte seziert und in sprachlicher Unmittelbarkeit eindrücklich wiederbelebt. So begegnen wir einer ganzen Reihe an Akteur*innen, die ihren Auftritt im Wiedererinnern haben: dem Gauleiter, dem Geldeintreiber, der Fürsorgeschwester und der einzigen jüdischen Familie; dem Deserteur und dem Heimwehrführer, dem Widerstand und denen, die Euthanasie und Zwangsabtreibungen ausgesetzt wurden.
Verbunden werden die Beleuchtungen der Vergangenheit durch den Weg, den die Autorin durch Dornbirn nimmt: vom Rathaus aus über den Marktplatz und die Marktstraße am Dornbirner Bundesgymnasium vorbei, über die Sägerbrücke zum Stadtspital. Und immer stehen die Menschen und ihre Unternehmungen eingebettet in historisches Faktenwissen im Mittelpunkt der Erzählung, die die Autorin aus ihrer aufmerksamen Recherche komponiert.
Achtzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat Irmgard Kramers Rekonstruktion des Vergangenen und die darüber schwebende Motivation größte Aktualität. So hält die Autorin fest:
Nach dem Krieg schlugen wir den Deckel drauf und hofften, dass der faulige, brodelnde Sumpf von selbst abkühlen würde. Aber wie hoch ist die Halbwertszeit von Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Geht das von selbst weg? Oder muss man – einmal wenigstens – hinsehen?
Wie wäre es mir damals ergangen?
Wie hätte ich mich verhalten?
Wie hättest du dich verhalten?
(S. 14)
Hinsehen – einmal wenigstens – müssen wir alle. Irmgard Kramer hat das Hinsehen auf mehreren Ebenen durchgemacht und daraus eine Erinnerung geflochten, die lesenswert und kratzig ist, die ein unbequemes Gefühl in die Magengegend pflanzt und gleichzeitig den Blick für das eigene Erinnern neu poliert. Wie hätten wir uns verhalten? Die Frage bleibt über die Lektüre hinaus stecken und lässt uns Lesende mit dem Drang zurück, einmal mehr den Spektralfarbenbogen der Vergangenheit als solchen anzuerkennen und ihn nicht in rein braune, rosige oder schwarzweiße Töne zu färben.
iris gassenbauer |
|
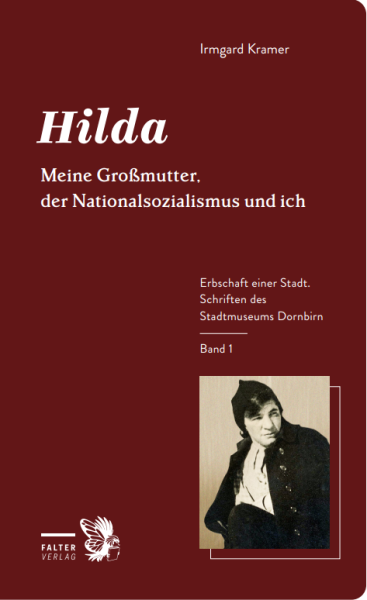
|
_______________________________
Februar 2025
|
|
|
Andrea Winkler: Mitten im Tag, Sonderzahl 2025
Andererseits könnte man auch ein Gedicht aufsagen, und am Ende lachen, wie man noch nie gelacht hat. Es beginnt damit, was einer tun würde, wenn er sein Leben noch einmal leben könnte. Ich zum Beispiel würde dann niemals klüger sein wollen, als ich bin.
(S. 21)
Was täten wir, wenn wir das Leben (wissentlich) noch einmal leben würden? Hin und wieder Gras über das Gesicht wachsen und kleine Spalten zwischen den Halmen frei lassen? Einen alten Gedanken so beständig und geduldig wiederholen, bis er einem wirklich wird? Oder vielleicht Bilder betrachten, auf denen jemand auf seinen Fersen sitzt und anderen aus einem alten Buch vorliest?
In Andrea Winklers Erzählband „Mitten im Tag“ findet sich all dieses Tun, finden sich diese beinahe traumwandlerischen Unternehmungen zwischen dem Geschehen und dem Imaginieren und schlüpft das Vorstellbare in die Realität der Personen, die in den verschiedenen Erzählungen zu Wort kommen. Sanfte, feinsinnige und niemals störrische Erzähler*innen, die stets zwischen die Dinge blicken, an ihren Rändern entlang und dort über Wahrnehmungsgrenzen hinweg. Die Liminalität wird zur neuen Mitte und erlaubt ein unverstelltes Empfinden, das direkt aus den seidendünn gesponnenen Worten der Schriftstellerin entwächst. Dazu stimmt sich die Natur in aus Gräsern, Blattwerk und Windspielereien entstandenen Bildern ein, ebenso traum-haft wie fassbar.
Den Naturen aber fehlt das Enthobene, das sie in weniger bedachter Komposition zu einer Leinwand des Kitsches gemacht hätte; Nein, Andrea Winkler gelingt das sprachliche Kunststück, sie stets wieder zu verhaften und in Relation zu setzen mit der Wirklichkeit der Erzählenden.
Ich nickte und sah zu bewaldeten Hügeln hinauf, durch die sich schmale Pfade schlängelten. Einen davon fand ich am kommenden Morgen und folgte ihm; er führte an den Resten einer Steinmauer vorbei, an Brombeerhecken, trockenen Fichten und einer Frau, die ihren Enkelkindern erklärte, wie man Pilze unterscheidet. Sei, fragte sie, etwa ausgeschlossen, dass auch in Zukunft noch welche wüchsen? Beim Wort Zukunft war mir, als müsste ich augenblicklich etwa Wichtiges vollbringen, etwas, das mir ständig entfiel und das zu heben ich kaum vermochte, wenn ich auch fest entschlossen dazu blieb.
(S. 73)
Den Erzählungen werden „Mitten im Tag“ essayistische Beobachtungen angereiht, die in der Sprache des „Ich“ fortgeführt an die Fragen der vorherigen Protagonist*innen anzuknüpfen verstehen. Wo findet sich das Wunderbare in der Welt und wie sei die gegebene Zeit so zu verbringen, dass sie – ohne Produktionszwang und Zukunftshörigkeit – ergiebig erlebt werden kann?
Die Antworten deutet Andrea Winkler nur an, wir müssen sie schon selbst für uns finden. Ein Grundrezept dafür steckt sie uns aber in die Brusttasche, als Nebensatz auf ein halbes Notizblatt vermerkt: Es liege viel daran, den Gegenständen Raum zu geben, die von sich aus Stille brauchen (S. 133). Nicht jeder Frage muss stante pede die Antwort folgen, unzerkaut und womöglich übereilt herausgeschüttelt. Das Schweigen und die kurze Ratlosigkeit zwischen den Sätzen kann etwas Gutes ergeben, etwas, das uns Leser*innen in der Gegenwart der schnellen Konklusionen wohltuend entgegentritt. Nehmen wir uns also Zeit für „Mitten im Tag“ und für die Fragen, die Andrea Winkler geschickt adressiert, nehmen wir uns Zeit, in unserer eigenen Schrittlänge die Antworten im Außerhalb zu suchen, im Schweigen und in der kurzen Ratlosigkeit zwischen den Sätzen.
iris gassenbauer
|
|
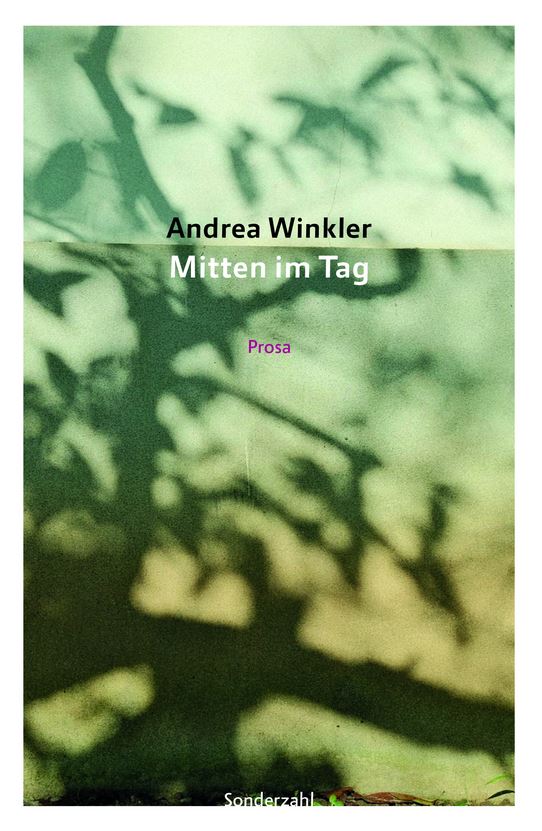
|
_______________________________
Jänner 2025
|
|
|
Hannah Oppolzer: Verpasst, Braumüller 2023
Der Name der Autorin kommt Ihnen bekannt vor? Kein Wunder! Hannah Oppolzer ist ja auch die Verfasserin des 3. Skripts des Fernkurses „klassikLESEN“!
In ihrem Debütroman „Verpasst“ beweist sie gekonnt, dass sie nicht nur das theorielastige, sondern auch das literarische Schreiben richtig gut drauf hat – aber überzeugen Sie sich ruhig selbst.
„Verpasst“ erzählt nicht nur eine Geschichte, sondern gleich mehrere und mäandert dabei zwischen den Perspektiven.
Da ist einmal Emma, die Tochter. Da sind aber auch Emmas Vater und vor allem Emmas Mutter, deren Sichtweisen direkt aus der Erzählung dringen und das vielfältig vertrackte Familienleben in ihr jeweils persönliches Scheinwerferlicht rücken. Und dann sind da auch noch die anderen, die Kurz- und Langzeitbekanntschaften, die sich in und aus der Geschichte schieben und dabei ihre Spuren hinterlassen.
Im Mittelpunkt aber steht das Dazwischen; der komplizierte Raum zwischen den Menschen, der einmal von mehr, einmal von weniger Nähe bestimmt ist, einmal von Angst, dann wieder von Geduld und Hoffnung. In verknappten Dialogen zeigt sich die ganze Schwere und Leichtigkeit des Seins im Familien- und Freudesverband, in den jeweils antrainierten Rollen und den Routinen, die zu durchbrechen die eigentliche Herausforderung ist. Der Wunsch nach schalldichtem Schutz stellt dabei der Sehnsucht nach Freiheit ein Bein und eine Person nach der anderen stolpert darüber
Er hat von Anfang an gewusst, dass sie zerbrechlich ist. Nicht schwach. Schwache Menschen müssen vor stärkeren beschützt werden, zerbrechliche Menschen vor sich selbst.
(S. 95)
So blickt Emmas Vater auf seine Frau und so blickt er weiter auf die vielen Risse, die zwischen Mutter und Tochter im Lebensverlauf aufsprangen. Es funktioniert nicht so recht, das Elterndasein.
Er ist mitschuldig daran, dass Mutter und Tochter sich nie in die Augen sehen konnten, aus Angst, den Menschen zu entdecken, der in der anderen wirklich steckt.
(S. 95)
Genau jenes Entdecken und Wegschauen durchzieht „Verpasst“ und spiegelt sich in den Interaktionen schmerzhaft eindringlich wider, ohne dass es jemals zum großen Knall käme. Eher liegt das Ausmaß der Dinge im Kleinen, in den Nebenbeibeobachtungen, die Hannah Oppolzer in ihre Bildersprache packt:
Er umschlingt sie von hinten mit beiden Armen. Der Spiegel wirft ihnen das Bild eines glücklichen jungen Paares entgegen.
Georg sagt: Es kann ja nicht jeder so eine gute Beziehung haben wie wir beide, und küsst sie auf den Hals. Emma ringt sich ein Zahnpastalächeln ab. Plötzlich scheint das Bad viel zu klein für zwei Personen und die überdimensionale Menge an Schuldgefühlen, die jetzt zur Tür hereinspaziert. Sie blickt in Georgs Spiegelaugen und ihr wird klar, dass das die einzige Art ist, wie sie ihm noch in die Augen sehen kann.
(S. 149)
„Verpasst“ ist eine Erzählung des Aneinandervorbeis und Mittenhindurch, ein starkes Debüt, das Vorfreude auf mehr macht.
iris gassenbauer |
|
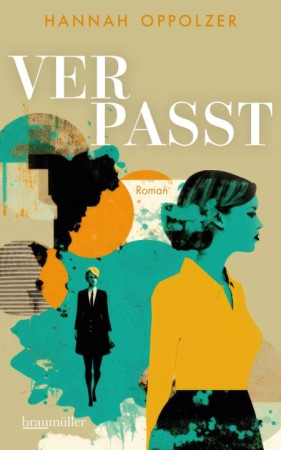
|
_______________________________
Dezember 2024
|
|
|
Monika Helfer: Wie die Welt weiterging. Geschichten für jeden Tag, Hanser 2024
Unser Buchtipp für den Dezember (und das folgende Jahr!), entstammt der Feder einer österreichischen Autorin, die nun schon öfters bewiesen hat, ebenfalls das Zeug dazu zu haben, in der Zukunft als echte Klassikerin behandelt zu werden. Echte Klassiker, so heißt es ja in der Lehrmeinung, sind zeitlos, haben auch über Jahrzehnte hinweg Relevanz und zeichnen sich durch einen besonderen Stil aus. All das vereint Monika Helfer, deren „Wie die Welt weiterging“ nicht nur mit einer Erzählung, sondern gleich einer ganzen Wagenladung voll Geschichten ins neue Jahr überleitet.
Es ist ein ganz schön gewichtiges Buch, rund 760 Seiten und doch federleicht. „Nun, so ganz stimmt das nicht!“, rufen die aufmerksamsten Buchenthusiast*innen, bringt es doch fast ein Kilo auf die Buchwaage. Was die Form aber angeht, ist es kurz, knapp, wolkig. Zu diffus formuliert? Lassen Sie es mich anders probieren: „Geschichten für jeden Tag“ ist der Untertitel und das dürfen wir auch ernst nehmen: In 365 kurzen Erzählungen präsentiert uns Monika Helfer einen Geschichtenschatz, der in allen Facetten schimmert. Tragisches neben Komischem, Erhebendes neben Betrüblichem und das auf jeweils knappen 1,5 Seiten. Mehr benötigt die Vorarlbergerin nicht, um in den Lesenden das Gefühl zu erwecken, tief in ihre Worte abtauchen zu können. Das schafft die Schriftstellerin einerseits durch die Beschreibung der jeweiligen Kulissen, die schon mit den ersten Sätzen fassbar vor uns liegen. Das liegt aber auch an den Figuren, an Greisinnen, Bärenvätern und Schwestern, die die Autorin mit nur wenigen Strichen so lebendig skizziert, dass sie vor unseren Augen aus den Seiten treten.
Es sind Erzählungen der Kurzen Form, die mit direktem Einstieg oft abrupt abbrechen, als hätte man nur ein Gespräch nebenan im Zug mitgehört und müsste dann aussteigen. Aber auch, wenn die Enden unerzählt bleiben, lassen sie uns nicht frustriert und mit quälenden Fragezeichen zurück. Im Gegenteil; Monika Helfer lässt die Narration ausschwingen, ohne ein abschließendes Wort, eine Moral, einen Schlussakkord zu formulieren. Sie schenkt uns so Gedankenbilder und gepinselte Erinnerungen, die in unseren Köpfen weiterlaufen können. Und das jeden Tag.
Für Lesende mit System ist das Buch wunderbar, jeden Tag eine Geschichte. Dazu benötigt es aber auch Disziplin, denn es ist ein wenig wie mit Schokolade – nur nach einer aufzuhören, fällt schwer.
Für Lesende ohne System ist das Buch ebenfalls wunderbar, man kann wahllos hineinblättern, den Finger zwischen die Seiten stecken und eine Geschichte dem Zufallsprinzip überlassen.
Den Anfang der Geschichte Nr. 88 habe ich heute für Sie mitgebracht: Die Frau mit dem Glücksklee.
Sie war die Frau, die, wann immer sie auf einer Wiese stand und sich bückte, einen Glücksklee fand. Sie hatte weit über hundert in einer Zigarrenkiste ihres Mannes aufbewahrt. Man hätte meinen können, sie wäre überbeschenkt vom Glück, was aber nicht stimmte. Sie war eine frustrierte Frau. Sooft es sich anbot, schenkte sie Bekannten einen ihrer Glücksklees. Die hatten wohl Glück, zumindest der eine oder andere, Wunschkinder wurden geboren und Ehemänner gefunden.
[…]
S. 184.
Wie die Geschichte nun weitergeht, können sie selbst herausfinden. Wir aber wünschen Ihnen ebenfalls im neuen Jahr, wann immer Sie auf einer Wiese stehen, einen Glücksklee zu finden – oder zumindest jemand um sich zu haben, der Ihnen im entscheidenden Moment ein vierblättriges Kleeblatt schenkt.
.
Iris gassenbauer
|
|
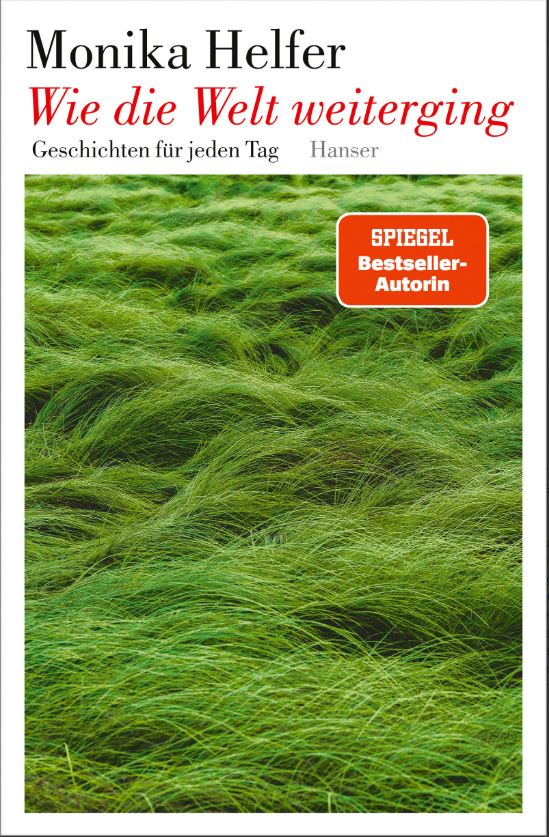
|
_______________________________
November 2024
|
|
|
Robert Louis Stevenson: Dr. Jekyll & Mr. Hyde und andere Gruselgeschichten. Reihe Große Schmuckausgabe, Coppenrath 2024
Robert Louis Stevenson – ein Name, der mit großen Klassikern verbunden wird und es deswegen auch in unseren November-Lesetipp geschafft hat. Wenn Ihnen nun als erstes „Die Schatzinsel“ einfällt, so müssen wir Sie von tropischer Wärme in Richtung britischer Nebelstimmung entlang der Londoner Themse entführen. Dort nämlich treibt ein gewisser Mr. Hyde sein Unwesen und versetzt die Stadt in Schrecken.
In der Schmuckausgabe des Coppenrath Verlags, die in einem äußerst schicken Layout das Auge erfreut, werden aber gleich mehrere Erzählungen und Novellen des Autors versammelt – darunter auch solche, die bisher den meisten Leser*innen entgangen sein dürften. Wer sich zwischen Kurzgeschichten wie „Der Leichenräuber“ (1884), „Der Flaschenteufel“ (1891) oder auch dem postum veröffentlichen „Die Versprengten“ (1914) wohligen Schauer über den Rücken rieseln lassen möchte, ist hier also genau richtig. Ergänzt wird die Auswahl der novemberdüsteren Novellen aber nicht nur durch das stimmige neongrün-schwarze Design und teils historische Illustrationen. Der Schmuckausgabe liegen auch zehn Beilagen bei, die zwischen den Buchseiten versteckt für haptische Überraschung und eine Erweiterung der Texte sorgen. Vom Filmplakat über ein Briefkuvert samt Schreiben Henry Jekylls an dessen Kollegen Dr. Lanyon bis hin zur Einführung in das moderne Duellwesen des 19. Jahrhunderts sind die Beilagen als anregende „Darüberhinauslektüren“ eine Ergänzung, die für besonderes Lesevergnügen sorgen.
Wer sich zusätzlich zu Autor und Werk informieren möchte, wird im Nachwort (von Übersetzer Martin Engelmann) und den ergänzenden Anmerkungen zu den Texten fündig. Hier heißt es zum eindringlichen Stil des früh auf Samoa verstorbenen Autors:
Stevensons Erzählungen sind gekennzeichnet von der Konzentration auf das Wesentliche. Seine straff gebauten und rhythmisch strukturierten Geschichten erreichen aufgrund des Verzichts auf Ausschmückung ein Höchstmaß an Präzision. Weitschweifige Schilderungen von Szenerien sucht man vergebens, statt Stimmung gibt uns der Autor Handlung, meist vorangetrieben durch den dramatischen Dialog. Kampf dem Adjektiv!, lautete eine Devise Stevensons, die ausdrückt, was er als redlichen Umgang mit erzählerischen Mitteln ansah. An der Tatsache, dass sich bei dieser bewussten Beschränkung dennoch immer eine Atmosphäre einstellt, die den Leser gänzlich in die Handlung eintauchen und das Umfeld selbstständig bis zur Anschaulichkeit ergänzen lässt, zeigt sich die hohe Kunst Stevensons.
(S. 264)
In der Reihe Große Schmuckausgaben des Coppenrath Verlags sind gleich mehrere Klassiker zu finden und sie alle kommen als wahre Hingucker an. Glänzender Seitenschnitt, geschmackvolle Illustrationen und ein farblich durchkombiniertes Layout machen nicht nur Sammler*innen Freude. Vor allem aber die Beilagen, die in unterschiedlichen Formen und Formaten lose zwischen den Seiten zu finden sind, machen die Lektüre zu einer freudigen Ostereier-Suche.
Mit „Robert Louis Stevenson: Dr. Jekyll & Mr Hyde und andere Gruselgeschichten“ machen sich nicht nur beinharte Fans der Schauerliteratur eine Freude. Auch für Freund*innen spezieller Sammel-Ausgaben ist die Schmuckausgabe ein Buch, das im Regal (oder auch am Nachttisch) bei Groß und Klein für Aufmerksamkeit sorgt.
Iris gassenbauer |
|
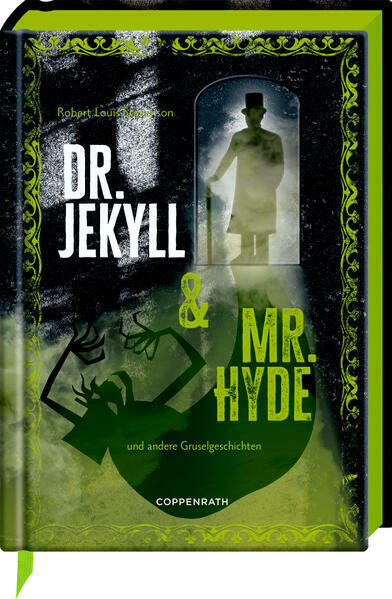
|
_______________________________
Oktober 2024
|
|
|
Italo Calvino: Warum Klassiker lesen?
Fischer, 2013
Es scheint die passende Frage zum Auftakt des Fernkureses „klassikLESEN“ zu sein:
Warum eigentlich sollen / müssen /können wir uns mit den Klassikern der Literatur beschäftigen?
Jeden Tag kommen neue Erscheinungen auf die Ladentheken, gefühlt rückt Minute um Minute eine Publikation nach, die vielversprechend klingt…und dann sind da auch noch die manchmal unendlichen Listen an noch zu lesenden Büchern, an Buchtipps und Leseempfehlungen, die wir mit uns herumtragen. Haben Klassiker da überhaupt noch Platz? In seinem Standardwerk zum Thema der großen Klassiker geht der in San Remo aufgewachsene Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Italo Calvino der Frage nach, warum es sich sehr wohl lohnt, Klassiker zu lesen, warum aber kein Zwang dazu besteht. Das hört sich in Calvinos lockeren Worten so an: Der einzige Grund, den man anführen kann, ist der, daß es besser ist, die Klassiker zu lesen, als sie nicht zu lesen. (S.14). Calvino ist kein Klassiker-Missionar, der uns Lesende davon zu überzeugen versucht, dass wir in ewiger Ignoranz tappend ein unerfülltes Leben leben werden, wenn wir nicht diese 50 oder jene 100 Klassiker (mehrfach) gelesen haben. Aber er ist ein Fürsprecher, der in seinem Werk neben einer kurzen Einführung viele praktische Beispiele heranholt und auf ihre Klassikertauglichkeit hin abklopft. Darunter finden sich auch viele Werke, die heute kein Teil des klassischen Kanons mehr sind und es vielleicht durchaus wert wären, wieder ausgegraben zu werden. Von Candide über Daisy Miller, von Zwei Husaren bis hin zu Robinson Crusoe beschäftigt sich der 1985 in Siena verstorbene Calvino, dessen Werk zum italienischen Volksgut gezählt wird, mit Altbekanntem und womöglich Schonvergessenem, das es dennoch wert ist, im Lichte der Klassiker diskutiert zu werden.
Iris gassenbauer |
|
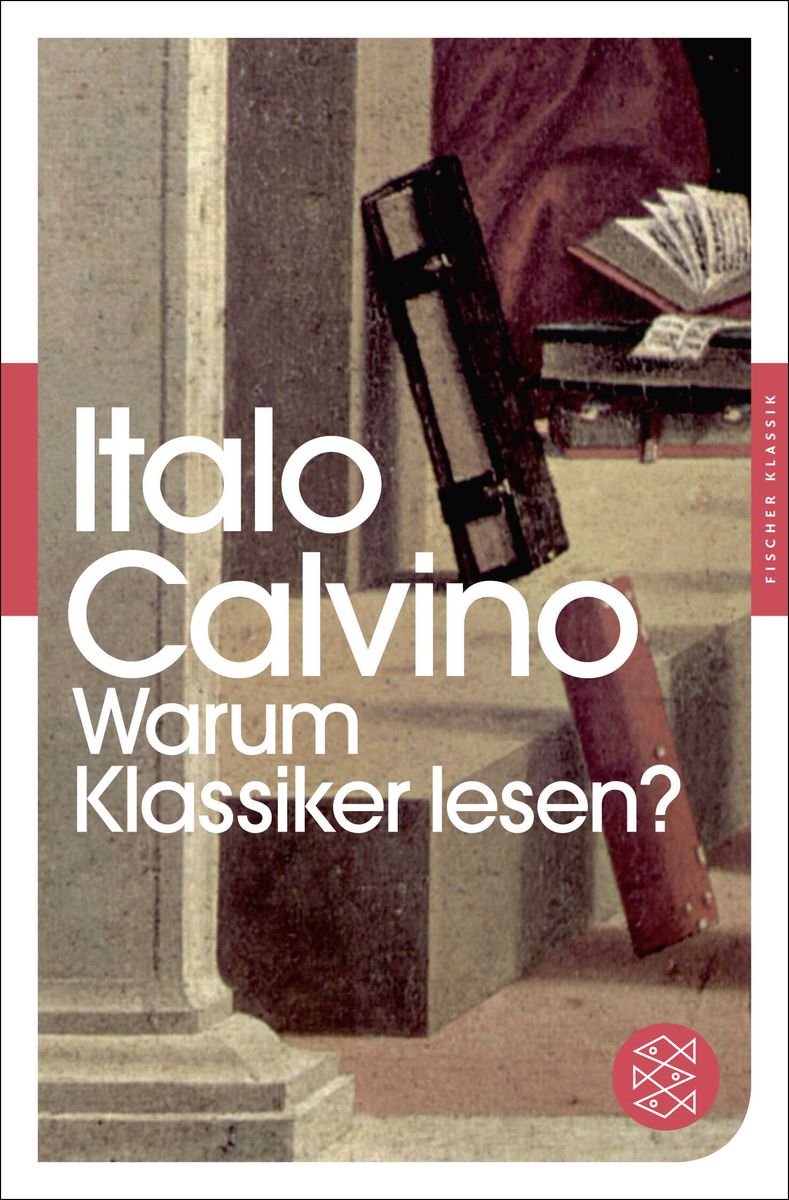
|
_______________________________
September 2024
|
|
|
Florian Weiß und Lucia Jay von Seldeneck: Was eine Kiefer ist. Geschichten aus der botanischen Welt
Kunstanstifter 2024
Sie sind unser ewiges Zuhause.
Sie zeigen uns jeden Tag, dass alles mit allem verbunden ist.
Dass sie die Verbindung sind.
Und in jeder Geschichte in diesem Buch schwing es ja mit: Sie, die Pflanzen, sind sowieso.
Und sie sind auch der Grund, warum wir als Leser*innen überhaupt ein Buch in Händen halten können. Denn, so viel ist gewiss, ohne Pflanzen keine Bäume, kein Papier und ergo keiner Bücher. Grund genug also, ein Sachbuch über Pflanzen genauer unter die Lupe zu nehmen. Aber die Kröte des Monats rein als Sachbuch zu bezeichnen wäre vollkommen verkürzt… Aber alles der Reihe nach. Beginnen wir bei den Basics und einem Steckbrief dieses Buches:
Ein Sachbuch über Pflanzen, wie es dieses auf den ersten Blick zu sein scheint, braucht zunächst ein Ordnungssystem: Wissenschaftlicher Name, Aussehen, Vorkommen, Status. So weit so gut. Was weniger klassisch für ein Sachbuch über Pflanzen ist, sind etwa der hier vorangestellte Text, der zugleich auch das Vorwort bildet oder die Kategorie des Songs. Und darin liegt der besondere Reiz dieses hochwertig gemachten Buches: 26 Pflanzen aus der ganzen Welt finden hier zusammen und zu ihnen 26 erzählende, erklärende oder auch lyrische Texte, die ein Stück weit Literaturgeschichte nachzeichnen, dabei aber auch gesellschaftspolitische und historische Aspekte in den Blick nehmen.
Wussten Sie zum Beispiel, dass der Klatschmohn, im englischen Poppy genannt, als Erinnerungszeichen für den ersten Weltkrieg steht, da das Gedicht „In Flanders fields the poppies blow / between the crosses, row on row“ zu den bekanntesten lyrischen Werken aus dieser Zeit zählt?
Damit verwoben werden bionische Vorbilder und Naturmaterialien, die sich der Mensch über Jahrhunderte hinweg zu Nutzen gemacht hat. Der Kork beispielsweise, so erfahren wir, wird nicht nur für die Herstellung von Flaschenverschlüssen oder Geldbörsen verwendet, sondern diente auch als Material für ein Kleid von Lady Gaga.
Dieserart entsteht ein regelrechtes Kaleidoskop an Pflanzen, die in ihrer Ganzheitlichkeit im Sinne einer kulturgeschichtlichen Aufladung textlich und illustratorisch skizziert werden. Dabei werden gängige Pflanzen wie etwa die Rose oder der Apfelbaum guten Gewissens außen vorgelassen und stattdessen auf ungewöhnlichere Beispiele wie Heilkräuter, Kakteen, Golftange oder Cocastrauch fokussiert und die Wunderwelt rund um diese Pflanzen ergründet. Jedem Gewächs werden dabei zwei Doppelseiten gewidmet, auf denen in luftigem Layout die biologischen Hardfacts der Pflanzen mit der kulturellen Welt der Menschen und dem Nutzen für unser Leben in Einklang gebracht werden. So vielfältig wie die Pflanzen, die hier portraitiert werden, sind die Texte, in denen je eine genannte Pflanze zum Star wird: Ob Hildegard von Bingen (Farne), eine Geschichte aus dem zweiten Weltkrieg (Torfmoose) oder ein Schwank aus einem Konferenzzimmer einer Werbeagentur in Detroit (Fingerhut). In den kuratierten Texten wird deutlich, wie omnipräsent – auch in unserem Sprachgebrauch – Pflanzen sind.
Omnipräsent sind in diesem Buch auch die feingliedrigen Illustrationen von Florian Weiß, der dafür eine Punktiermaschine nach dem Vorbild eine Tätowiermaschine eingesetzt hat. Die genutzte Farbpalette orientiert sich dabei ganz an der Natur. Neben Aquarellfarben kommen allerlei Natursäfte zum Einsatz: Ob Erde, Pflanzenextrakte, Wein, Kaffee, verschiedene Gewürze oder sogar Blut. Die Bezeichnung eines Natursachbuches ist hier also auch in der Farbgebung Programm. Die portraitierten Pflanzen werden dabei unterschiedlich in Szene gesetzt: in kleinen schwarz-weiß-Vignetten, detailgetreuen Abbildungen von Blüten, Blättern, Stängeln und Stämmen und großflächigen, manchmal sogar seitenfüllenden Illustrationen. In diesen finden nicht nur Entwicklungsstadien der Pflanzen ihren Platz, sondern entsprechend zur Textsortencollage schafft der Künstler ein mehrteiliges Gesamtbild, in dem kulturgeschichtliche Aspekte und die Bedeutung der Pflanze für den Menschen gekonnt ineinander verflochten werden. Fast wie alte Bildtafeln oder historische Bestimmungsbücher anmutend geben die Bilder einen fein kolorierten Einblick in die Fülle an Bedeutungen einer einzelnen Blume, Pflanze, Blüte. Dabei erinnert das Buch auch an Linda Wolfgrubers „Die kleine Waldfibel“, 2020 ebenfalls bei Kunstanstifter erschienen.
Aus österreichischer Perspektive ist natürlich eine Blüte besonders interessant: Das Alpen-Edelweiß, das heute stark gefährdet und einst von Kaiser Franz Joseph I. für seine Sisi am Großglockner gepflückt wurde (so erzählt es zumindest die Legende). Zudem verkörpert es Werte wie Liebe, Mut, Treue und Gemeinschaft.
Am Ende des Buches haben wir als Leser*innen viel gelernt: Unter anderem auch, dass es in Spitzbergen in den Tiefen des Permafrosts eine Samendatenbank gibt, die mit 1. September 2023 1.255.332 Saatgutproben aus 99 Genbanken mit insgesamt 6.120 Arten von Pflanzen beheimatet, die das Überdauern der Pflanzenwunderwelt unserer Erde sichern sollen. Und mit dem Zitat „We hope that the seeds that are stored here are never needed.“ Dafür gilt es Sorge zu tragen, denn wie eingangs erwähnt wurde:
Sie sind unser ewiges Zuhause.
Sie zeigen uns jeden Tag, dass alles mit allem verbunden ist.
Für alle jene, die sich auch musikalisch mit den Pflanzen in diesem Buch verbinden wollen, steht auf Spotify eine Playlist bereit, die alle Songs versammelt, die von der Autorin assoziativ zu den Pflanzen im Steckbrief angeführt werden: https://open.spotify.com/playlist/01WpaAFJl1xErKs7zahv68?si=d120ddc9b48a485d&nd=1&dlsi=957b738fcc484910.So mit (mindestens!) einem Ohrwurm versorgt, etwa „Ein kleiner grüner Kaktus, steht draußen am Balkon …“, lässt es sich beschwingt durch dieses wunderbare Buch blättern und einen Teil der irdischen Pflanzenwelt ergründen.
Alexandra Hofer
Wissenschaftlicher Name: Sachbuch
Familie: Literatur
Aussehen: 132 Seiten stark, fest gebunden, mit weinrotem Leinenbändchen und Prägung auf dem Cover
Lebensraum: Bibliotheken von Menschen, die hochwertige Bücher lieben
Status: druckfrisch
Einordnung: Kunstbuch, Sachbuch, Lexikon …
Songs: Frogs, Frösche (zugegeben: Lieder über Kröten gibt es nicht allzu viele …)
Dieser Lesetipp ist zugleich die STUBE Kröte des Monats September 2024.
Wenn Sie noch mehr STUBE Kröte des Monats Tipps lesen wollen, dann besuchen Sie die Webseite der STUBE unter: STUBE |
|

|
_______________________________
August 2024
|
|
|
Franziska Winkler (Hg.). handverlesen – Gebärdensprachpoesie in Lautsprache
hochroth 2023
Lyrik ist Text. So viel ist klar. Und Lyrik, was ist das eigentlich? Ein Geflecht, das erst durch Text und Oralität so richtig entstehen kann, etwa, wenn ein Gedicht auch vorgetragen wird? Dass es auch andere Möglichkeiten der Artikulation von Lyrik gibt, beweist die Literaturinitiative handverlesen. Emanzipatorisch und mehrsprachig präsentiert die Initiative Gebärdensprachpoesie, die über konventionelle Textproduktion hinausreicht und den Blick für andere Arten des künstlerischen Ausdrucks öffnet. Auf der Webseite der Initiative heißt es:
Wir fordern ein neues Verständnis von Literatur, das nicht nur schriftliche, sondern auch visuelle, gebärdete Texte einschließt. Die hörende Literaturwelt braucht endlich gebärdensprachliche Poesie und Prosa, sowie eine stärkere Präsenz Tauber Künstler*innen auf Bühnen und in Büchern.
(poesiehandverlesen.de)
Es ist eine barrierefreie Kunst, die gleichzeitig mit Barrieren spielt und dadurch ein divergentes Feld rund um Wort, Sprache und Ausdruck öffnet. Wie, fragen Sie sich nun vielleicht, kann diese Anthologie aussehen? Übersetzt in Lautsprache findet sich die Lyrik der Gebärdensprachenpoet*innen hier als Text, in die Form des Buches gepackt, wieder. Darüber hinaus bietet die Publikation aber mehr und spielt mit den Möglichkeiten der Multimedialität. Videos, die via Smartphone angewählt werden können, eine Webseite, die durch Augmented-Reality neue und parallele Welten öffnet und die schlicht abgedruckten Schwarzschrift-Texte lassen aus dem handtellergroßen Anthologie-Büchlein ein Zusammenspiel der Ausdrucksformen werden, die sich sehen (und hören und lesen) lassen kann. Wer die Publikation „nur“ als Papierprodukt vor sich hat, kann den Text in seiner Buchstabenform von der Seite ablesen; wer allerdings mit dem Smartphone die verknüpften Textfelder scannt, liest die Anthologie über den Bildschirm als überraschendes Mehr an Medialität. So öffnen sich auf den Papierseiten plötzlich Videos, die die Gebärdesprachenpoet*innen bei ihrer Performance zeigen; mit dem Umblättern öffnen sich neue Einblicke in das Werk anderer Künsterl*innen.
Die Anthologie bietet mit einem Vorwort der Herausgeberin Franziska Winkler und einem Essay der Professorin für Gebärdensprachdolmetschen und Gebärdensprachen an der Universität Hamburg Prof. Liona Paulus auch den theoretischen Rahmen, der die Lektüre bereichert und neue Sichtweisen befördert.
Iris gassenbauer |
|
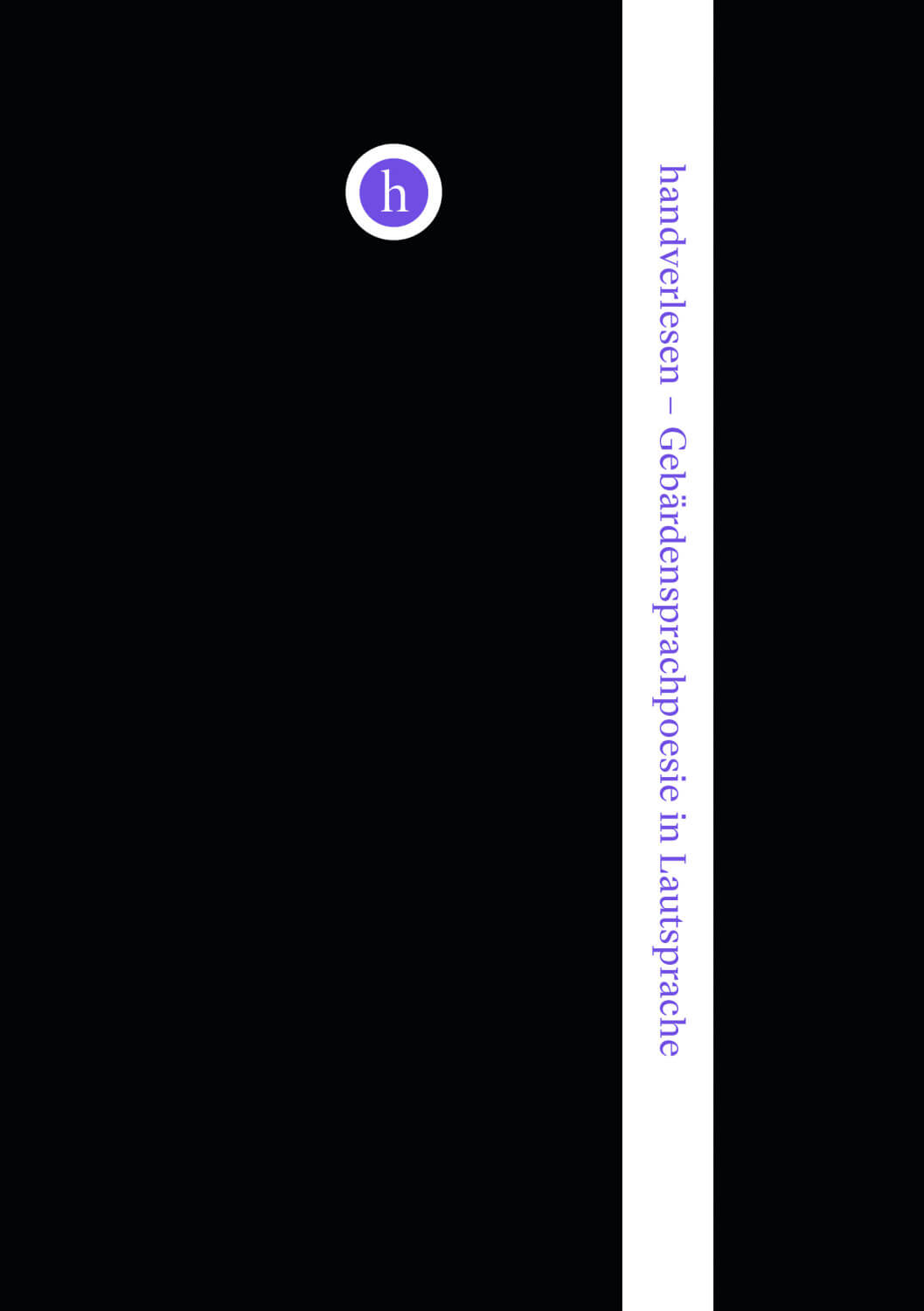
|
_______________________________
Juli 2024
|
|
|
Michael Hammerschmid. was keiner kapiert
Jungebrunnen 2024
Wer Michael Hammerschmid liest, muss sich auf Verschiedenes und Immerneues gefasst machen. Hat er erst in seinem letzten Band „stopptanzstill!“ Wiener Tierfiguren in seine Lyrik geschmeichelt und dabei die Hauptstadt in Maßeinheiten von Walen und Spatzen, Krokodilen und Wasserspeiern kartographiert (lesen Sie Heidi Lexes Rezension zu „Stopptanzstill!“ in unserem Lesetipp von Dezember 2023: https://www.literarischekurse.at/lesetipps.htm), ist es nun das Innerste, das auf eine lyrische Karte gespannt wird. Der aktuelle Lyrikband „was keiner kapiert“, unternimmt den Versuch, das „ich“ zu fassen; ein Unternehmen, das doch eigentlich scheitern muss. Doch vom Scheitern kann in Michael Hammerschmids poetischem Nachsinnen nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil: eben dort, wo das „ich“ durch alle Netze schlüpft, zeigt sich seine Komplexität:
no chance
[…]
ich bin nie so
merkgescheit wie du
doch schnell wie
ein nu und klein
bist du und gross
bin ich durch mich
und dich verläuft
ein strich und noch
einer und nochundnoch
denn selbst mit mir
bin ich nicht gleich
bin alt und jung
und fremd und weich
und tobend lieb
und schrecklich nichts
das biegt und schiebt
und streicht den strich
doch sicherlich
das hoffe und das fürchte
ich. […]
(S. 27)
Zwischen Zeilensprüngen scheint sich das „ich“ in seiner Selbstfindung immer wieder neu zu orientieren und in den Abgleich mit dem „du“ zu setzen. In seinem Stakkato der Gegensätzlichkeiten werden wir Lesenden staunend dieser Metamorphose gewahr und erinnern dank Michael Hammerschmids Wortkunst die Wandelbarkeit der Jugend wieder, die zwischen Suchen und vorläufigem Finden changiert. An anderer Stelle sind es bewusstseingeströmte konkrete Lebenssituationen, die das „ich“ in seinem sozialen Umfeld verdichten. Der Partybesuch wird so zum allgegenwärtigen Dröhnen:
Party
unter leute getaucht
durch den raum die
worte die blicke vor-
bei gekratzt und an-
geeckt nicht da und
dort doch weiter-
gerudert durch den
plunder […]
(S. 43)
Ganz in Blau illustriert ist der Band von Barbara Hoffman, die – wie die Poesie selbst – einmal konkreter, dann wieder in musterhafter Abstraktheit Bildausdruck findet für Michael Hammerschmids Wörterbilder. In Kombination ergibt sich daraus die Lektüre eines genüsslichen Durcheinanders, das Gedanken heranträgt und dann schmetterlingsgleich abflirren lässt und wir können verweilen oder auch leichtherzig über die kurz- und kürzesten Gedichte hinwegstreichen, die hier vor uns liegen. Michael Hammerschmid ist mit dem Band eine Sammlung an Ein- und Innerstblicken gelungen, die als Lyrikbuch sowohl für die leseerprobte Jugend poetische Ballungsräume bereithält, als auch ein lyrisch schon gereifteres Publikum zu überraschen bereit steht.
Besuchen Sie doch die Webseite Autors für weitere Infos: www.michaelhammerschmid.com
Iiris gassenbauer |
|
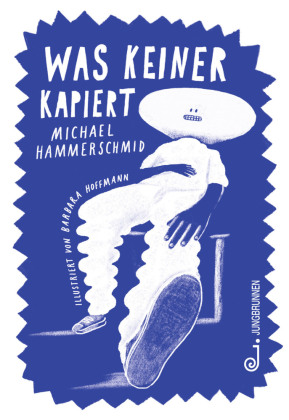
|
_______________________________
Juni 2024
|
|
|
Lütfiye Güzel. Ich.soll.ruhiger.werden.
go-güzel-publishing 2023
Zuerst klingt es wie ein Mantra, das zwischen bewusst mindfullen Atemzügen wieder und wiederholt wird: ich.soll.ruhiger.werden. / ich.soll.ruhiger.werden. / ich.soll.ruhiger.werden.
Sobald man aber in Lütfiye Güzels Gedichtband liest, wird aus der vorgekauten Ruhe eine hochkonzentrierte Präzision der Beobachtungen, die in minimalistischer Anwendung zu uns Lesenden spricht. Nichts mit Ruhe und Entspannung; vielmehr fordert der genaue Blick zum Mitblicken auf und zum Einlassen auf die freie Assoziation. Die 1972 im Ruhrgebiet geborene Schriftstellerin referiert in ihren Gedichten ebenso auf das „ich“, wie auf Grundlegendes: da ist die unbestimmte Tristesse des Alltags ebenso wie das Herabbrechen dessen, was einen ausgedehnten Glücksmoment möglich macht. Da ist Einsamkeit ebenso verankert wie das tiefe Hineinfühlen in die eigene Körperempfindung. Und schließlich ist da auch ein ausgewählter und scharfer Umgang mit dem Wort. Kein Geschnörkel, kein Geplauder, sondern harte Punktierung und eine Bestimmtheit, die der inhaltlichen Unsicherheit in Kontrast gegenübersteht.
In ihrem Schaffen ist die Autorin alles andere als minimalistisch. Umtriebig publiziert und kreiert sie und publiziert abseits der Konvention im eigenen Label „go-güzel-publishing“. Hier können ihre Werke auch direkt bestellt werden. Eine Übersicht über das Aktuelle gibt sie auf ihrer tumbler-Seite: https://luetfiye-guezel.tumblr.com/
Iris gassenbauer |
|

|
_______________________________
Mai 2024
|
|
|
Ruth Klüger: Gegenwind. Gedichte und Interpretationen
Wien: Zsolnay, 2018
2014 hat Ruth Klüger, Shoa-Überlebende, Literwissenschaftlerin und große Wortkünstlerin schon einmal die Interpretationsbrille auf die Nase gesetzt und sich Gedichte zur Brust genommen. Damals waren es in dem Band „Zerreißproben. Kommentierte Gedichte“ noch die eigenen, autobiografischen Werke gewesen, die Klüger vor sich selbst und den Leser*innen auszubreiten und zu sezieren verstand. Das Konzept gelang und wenn jemand so tief in der Sprache und der ihren Feinheiten steckt, ist es nur verständlich, das bald wieder die Lust auf Interpretation entflammen würde. 2018 also folgte „Gegenwind. Gedichte und Interpretationen“ – diesmal aber mit Fremdgedichten. Zwölf deutsch- und neun englischsprachige Gedichte versammelt Ruth Klüger in dem (viel zu) schmalen Band und tritt im Wechsel zwischen Ursprungstext und Interpretation in einen feinen Dialog.
Vorweg haben wir Leser*innen gemütlich Zeit, das Poem zu lesen, hernach folgt Ruth Klügers Ausführungen, die weder belehrend noch ausufernd daherkommen und sich auch nicht mit Allmachtsgehabe das Gedicht unterwerfen wollen. Nein, Klügers Interpretationen sind ein jeweils zarter, wenn auch wohlüberlegter Nachsatz, der die Assoziationsfähigkeiten und das Breitenwissen der 2020 verstorbenen Literaturwissenschaftlerin offensichtlich machen. Gleichzeitig aber bleibt ihr Schreiben über das Dichten ein jeweils knapper (kaum mehr als drei Seiten pro Gedicht langer) Nachsatz mit Gedankenanstößen und kontextbewussten Kommentaren.
Gedichte, so die Autorin im Vorwort, wären eine spielerische Gattung von Sprachexperimenten, die zwischen realistischer Weltbeschreibung und wortloser Musik akrobatische Kunststücke aufführen […] Gedichte sagen etwas aus, aber sie sind zu kompakt, um das Ausgesagte auch noch zu erklären. Wir Leser*innen könnten nun also zwar den selben Text lesen, nicht aber dasselbe Gedicht, denn jede*r trage eine eigene Interpretation in sich. Manchmal ist man verblüfft, wie anders ein Gedicht, das man zu kennen und zu verstehen meinte, eine andere Leserin berührt, man widerspricht dem Kommentar oder nickt in Zustimmung oder fühlt sich bereichert um einen neuen Gedanken. (S.5f)
Bereichert um gleich viele neue Gedanken lässt uns Gegenwind nach jedem Kapitel zurück. So tingelt Ruth Klüger leichtfüßig zwischen Adalbert von Chamissos „Das Schloß Boncourt“ an Georg Kreislers „Die Hexe“ vorbei, nimmt auch noch Durs Grünbeins „Die Wachtel“ mit oder versucht sich in den vorliegenden größtenteils eigenen Übersetzungen auch an englischsprachigen Gedichten von Emily Dickinsons "[A narrow fellow]" bis hin zu Anne Sextons "The Abortion".
Das Gedicht selbst bleibt Ruth Klüger, wie sie auch im Vorwort angibt, in seiner Verdichtung immer auch ein Rätsel oder ein Geheimnis. Der Unterschied zwischen diesen beiden verwandten Möglichkeiten ist der, dass ein Rätsel gelöst werden kann, während ein Geheimnis immer etwas Verborgenes zurückhält und uns im Unklaren belässt. Den Spalt, der sich zwischen diesen beiden Enden öffnen, zeigt sich in ihrer Interpretation des Aichinger Gedichts
Zeitlicher Rat
Zum ersten
mußt du glauben,
daß es Tag wird,
wenn die Sonne steigt.
Wenn du es aber nicht glaubst,
sage ja.
Zum zweiten
mußt du glauben
und mit allen deinen Kräften,
daß es Nacht wird,
wenn der Mond aufgeht.
Wenn du es aber nicht glaubst,
sage ja
oder nicke willfährig mit dem Kopf,
das nehmen sie auch.
(Ruth Klüger: Gegenwind, S. 47/ aus: Ilse Aichinger: Verschenkter Rat. Gedichte. Frankfurt: Fischer, 1978)
Ruth Klügers Interpretatorischer Ansatz bewegt sich auch hier vorsichtig zwischen der Möglichkeit des Rätsels oder des Geheimnisses, wenn sie schreibt:
Im Kontrast zu dem beunruhigenden Inhalt der Verse geht eine eigentümliche Ruhe vom Rhythmus und der Ausgewogenheit dieser Zeilen aus, also vom eigentlich Lyrischen. Das ist das Gleichgewicht vom „Zum ersten“ und „Zum zweiten“, die doch dasselbe bedeuten: Denn wer an den Tag glaubt, glaubt auch an die Nacht. Wer an das Leben glaubt, glaubt auch an den Tod. Und da ist der gesteigerte Stufengang – ob hinauf oder hinunter – in der wiederholten Ermutigung zum Glauben. Oder sind das nur die Beschwichtigungsversuche einer Lebenslüge? Man kann das Gedicht nämlich auch so lesen, dass der Unglaube siegt. Es beschwört einen vertrackten Zweifel in einer Schaukel von Glaube und dessen Ablehnung. Und der Zweifel ist ja leider nicht nur sprachlich mit der Verzweiflung verwand.
(S. 48f.)
Das tiefe Verständnis, mit dem sich Ruth Klüger durch die Poesie bewegt, ist keines, das dominieren und bestimmen will. Es möchte vielmehr erkunden, Optionen aufzeigen und Möglichkeiten andenken; genau das macht „Gegenwind. Gedichte und Interpretationen“ zu einem so lesenswerten Beitrag im lyrischen Diskurs.
Iris gassenbauer |
|

|
_______________________________
April 2024
|
|
|
Ingeborg Bachmann I Die gestundete Zeit - Salzburger Bachmann Edition
Herausgegeben von Irene Fußl. Mit einem Vorwort von Hans Höller. Enthält Fotografien und Faksimiles
Suhrkamp 2023
Die auf ca. 20 Bände angelegte Salzburger Bachmann Edition hat wieder Zuwachs bekommen. 2022 heimste die Neuausgabe von Bachmanns »Anrufung des Großen Bären« wegen ihres ausführlichen Kommentars viel Lob ein. Nach demselben Muster, aber womöglich noch kenntnisreicher und erhellender, dabei stets gut lesbar und ohne wissenschaftliches Brimborium, sind die Erläuterungen zum jetzt erschienenen ersten Lyrikband gestaltet.
Als kleine Sensation enthalten sie einen nicht abgeschickten, bislang weitgehend unbekannten Brief an den Dichter-Geliebten Paul Celan, der beweist, dass der Nachlass immer noch ungehobene Schätze birgt.
Mit Gedichten, die später in diesem Band abgedruckt wurden, trat die in Kärnten geborene und aufgewachsene Autorin 1952 erstmals vor der Gruppe 47 auf. Die überwiegend bundesdeutsch und männlich besetzte Schriftstellerrunde kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, als eine zerbrechlich wirkende junge Österreicherin mit leiser und bald ersterbender Stimme lyrische Texte vortrug.
Da gab es rätselhafte poetische Bilder, viele davon im Zwiegespräch mit Celan entstanden, aber auch Verse mit einer klaren politischen Botschaft »Der Held bleibt den Kämpfen fern«, heißt es in »Alle Tage«, dem vielleicht meistzitierten Gedicht des Buchs, in dem Bachmann für »Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls« plädiert.
Ein »neuer Stern am deutschen Poetenhimmel« war aufgegangen, so der Kritiker Günter Blöcker. Bachmann wurde bald zur mythenumwobenen Primadonna der deutschsprachigen Literatur.
Wie sehr ihr Leben und Werk bis heute faszinieren, hat erst kürzlich der Film »Reise in die Wüste« von Margarethe von Trotta gezeigt.
*bn* Renate Langer
Der aktuelle Lese-Tipp wird in Kooperation mit dem Österreichischen Bibliothekswerk in Salzburg, einem unserer Kooperationspartner im Fernkurs für Literatur >>> lyrikLESEN (Oktober 2023 bis Juni 2024) präsentiert!
|
|

|
_______________________________
März 2024
|
|
|
Frauen I Lyrik
Gedichte in deutscher Sprache. Herausgegeben von Anna Bers
Reclam 2022
In der Regel kann ein Reclam-Heft bequem in die Manteltasche gesteckt werden, wo es sich an den Oberschenkel schmiegt und nicht weiter auffällt. Dieser Versuch ist im Falle von „Frauen I Lyrik“ zum Scheitern verurteilt: Es ist ein monströser Reclam-Riese in dem sich 1055 Seiten zu 4,5 cm Gelbheit bündeln und in dem 500 Gedichte aus einem Jahrtausend ihren Platz finden. Und es ist eine Anthologie, die sich freigestrampelt hat von der Vorstellung, dass die große und wertvolle, die kanonwürdige und durch die Jahrhunderte in Schleife rezipierte Lyrik ganz selbstverständlich aus Männerköpfen stammt. So formuliert Anna Bers, Herausgeberin der Anthologie und Literaturwissenschaftlerin an der Georg-August-Universität Göttingen, im ebenso umfassenden Nachwort:
Die Literaturgeschichte wird mindestens bis zur moderne als eine Geschichte erzählt, in der die herausragenden Orientierungsfiguren (die kanonisierten Texte […]) aber auch ihre Nachahmer, Zeitgenossen, Schüler und Epigonen männlich sind. So wird die Wechselbewegung aus Innovation und Normalisierung immer gemessen an den Erzeugnissen dieser männlichen Geschichte. (S.951)
Hiergegen arbeitet „Frauen I Lyrik“ an. Chronologisch geordnet liegen die Gedichte mit dem Öffnen des Bandes vor uns Lesenden, so können spannende Kontraste, Lücken, Brüche, Dialoge und Fragen entstehen (S.7). Und tatsächlich führt die Lektüre durch die Jahrhunderte an Verkettungen oder auch Bruchstellen entlang, etwa wenn sich Nelly Sachs „Chor der Geretteten“ eben noch mit der Bitte:
Zeigt uns noch nicht einen beißenden Hund –
Es könnte sein, es könnte sein,
Daß wir zu Staub zerfallen –
vor euren Augen zerfallen zu Staub.
(S.562)
vor Ilse Schneider-Lengyels „Gott der Schläge“ reiht und dieser direkt in die Mitte der Geretteten die Peitsche zu schnalzen scheint:
Nicht genug /
Er teilt aus und peitschte
weitgespreizter Hand die Wogen.
Die Wasser brüllten
unter dieser Wucht. (S.562)
Nicht nur aus der Chronologie heraus lässt sich „Frauen I Lyrik“ erlesen; die Anthologie bietet darüber hinaus vier Perspektiven, die eine differenzierte Lektüre ermöglichen: Kanonbildung, Epochentypisches, Emanzipatorisches und die Verortung eines weiblichen Ichs beziehungsweise einer „weiblichen“ Stimme sind hier ordnungsgebend. Diese perspektivische Orientierungshilfe wird in einer Punkte-Symbolleiste abgebildet, die eine schnelle Zuordnung ermöglicht. Selbstständig an den jeweiligen Symbolleisten mitzuschreiben, dazu fordert das Vorwort auf: denn nicht alle Texte die z.B. aus der individuellen Sicht einer*eines Lesers*Leserin emanzipatorisches Potential besitzen, oder eine weibliche Sicht repräsentieren, wurden markiert. (S.11)
Ein Mitmachbuch? Zumindest eine Anthologie, die den Dialog offenhalten möchte und dabei reflektiert mit der eigenen Problematik umgeht. Denn hat es die binäre Unterscheidung in (Männer vs.) Frauen-Lyrik nötig und reproduziert sie nicht den Gedanken, dass es eine voneinander zu differenzierende männliche und weibliche Lyrik gäbe? Hiergegen setzt der horizontale Strich im Titel ein Zeichen.
Die Anthologie ist keine als Frauenbuch vermarktete Sammlung gedacht, sondern als (noch?) notwendiges Signal, das sich gegen die Tradierung qualitätvoller Lyrikproduktion und des Lyrikbetriebs als überdimensional männlich stellt. Gleichzeitig wird hier versammelt, was in Besprechungen, Buchlisten, vorangegangene Anthologien, in wissenschaftlichen Abhandlungen, Lehrwerken und nicht zuletzt Schullektüren unterrepräsentiert und nicht wahrgenommen ist: eine vielstimmige, erfrischende und rundum lesenswerte Lyrik-Auswahl. Und falls Sie sich die Frage schon gestellt haben: Ja, es sind auch männliche Stimmen vertreten – wenn diese weibliche Perspektiven in ihren Werken abzubilden versuchten.
„Frauen I Lyrik“ versteht sich nicht als abgeschlossen und versiegelt. Im Gegenteil, über den Rand hinaus verweisen die dargestellten Werke auf die Tatsache, dass Lyrik immer auch in einem engen Dialog mit ihrer Gegenwärtigkeit steht. So etwa in dem letzten angeführten Gedicht: einer Fotografie der Fassade der Alice Salomon Hochschule in Berlin, auf der Barbara Köhlers Lyrik das umstrittene Eugen Gomringer-Gedicht „avenidas“ ablöste.
Oder in Safiye Cans Antwortgedicht auf Hans Gysis „dichter“, das nun abschließend den Monat des Weltfrauentages beglänzen soll:
„Dichterinnen“
[…]
Dichterinnen schlecken Schlumpfeis
tragen übergroße Brillen
epilieren sich die Beine
und rauchen Gras.
Sie schreiben in der U-Bahn
sie schreiben in der S-Bahn
sie schreiben auf der Rolltreppe
sie schreiben beim Gehen
sie schreiben in der Badewanne.
Wenn sie nicht schreiben,
denken sie nach:
[…]
Dichterinnen sind unbeliebt
im Finanzamt
Dichterinnen werden beweint
wenn sie tot sind
und nicht mehr dichten
lang leben die Dichterinnen!
(S. 740)
Iris Gassenbauer
|
|

|
_______________________________
Februar 2024
|
|
|
Verena Rossbacher: Mon Chéri und unsere demolierten Seelen.
Kiepenheuer & Witsch 2022
Zuerst knackt der Zartbitterschokoladenmantel unter den Schneidezähnen, dann verteilt sich der Likör samt „Piemont“-Kirsche über die Zunge und hinterlässt ein sanftes, warmes Kribbeln hinter dem Brustkorb. Und auch, wenn kein Mensch bisher an einem Piemontkirschenbaum vorbeigekommen wäre (dabei müsste es bei 130 Millionen Kilogramm verzehrter Pralinen pro Jahr doch ganze Urwälder davon geben!), löst Mon Chéri im Gegensatz zum leistungssteigerungsorientierten Mutterkonzern-Bruder Pocket Coffee die nostalgisch verwaschene Vorstellung von Italo-Hügeln und mondäne Romantik aus.
Geschmacksknospen auf salzig und süß
Mon Chéri, dieses süßklebrige Wunderding der Sechziger, stellt nicht nur einen erheblichen Bestandteil des Speiseplans der Anfangsvierzigerin und Protagonistin Charly Benz in Verena Rossbachers Roman dar, sondern wird auch titelgebend. Wie die Likörpraline allerdings mit demolierten Seelen zusammenpasst, eröffnet sich erst nach und nach in einem Roman, der auf über fünfhundert Seiten sämtliche Gefühlsregister zu bespielen weiß.
Aber zurück zu Charly Benz, dieser verschusselten Schweizerin, die es nach Berlin-Kreuzberg verschlagen hat, wo sie Werbung für vegane Müsliriegel und andere Klimakatastrophenverhinderungen bei LuckyLili fabriziert und sich trotz aller brillant erdachter Marketing-Strategien vor ihren jüngeren Kolleg*innen ungewollt als Dinosaurier outet, der sich nicht in der schillerndschnellebigen Welt der Instagram- und Tiktok-Trends daheim fühlt.
Das Duckface wird zum Lippenbekenntnis der Unwissenheit, während Charly Benz selbst als textsichere Werbeslogansrezitatorin der 80er und 90er fungiert. Begleitet wird der Monolog der Protagonistin von einem Soundtrack, der ihr köstliches Psychogramm für die Lesenden mit Fußzeilen zu ihrer popkulturellen Verortung erweitert, denn die Musik hatte immer schon eine direkte Auswirkung auf ihr Verlieben. Und auch das Mixtape, das sie der Jugendliebe Dragaschnig damals als verschossene Teenagerin anonym bis auf den aufreizenden Hinweis: Let’s spend the night together. C. (S.312) zugesteckt hatte, taucht an späterer Stelle wieder auf, als besagter Dragaschnig die Kassette samt extra hierfür beschafftem Kassettenrekorder zur Aktion bringt. So erfüllt sich Jahre später mit musikalischer Untermalung der Plan der pubertären Charly:
Ich hatte damals gedacht: Ich liebe den Dragaschnig und der Dragaschnig liebt mich, und wenn er mich noch nicht ganz so fest liebt, wie ich ihn, dann tut er es, nachdem er meine Mixtapes gehört hat. (S.312).
Gleichzeitig strudelt das Leben der Charly Benz in Richtungen, wohin es die äußeren Einflüsse lenken. Weil das Briefe-Öffnen zur unerträglichen Belastungsprobe wird, wird der Dienst des Postengels Schabowski – Verzeihung – Herrn Schabowski in Anspruch genommen und etwas Struktur in dem kreativen Durcheinander aus Feiertagszigaretten, Notfallssilvesterfeiern und dysfunktionalen Fahrrädern als Quasitransportmittel der Wahl installiert. Bis, ja bis auch hier das Unerwartete einbricht, das hinter jeder Ecke des Lebensweges lauert: Schabowski ist krank, soviel darf gespoilert werden, richtig krank.
Und Charly Benz ist bereit, an der Seite des Postengels Klangschalentherapien und Aufmerksamkeitsmeditationen zu durchsitzen, Räucherstäbchenduft und Nikotinkaugummis inklusive.
Gipfelstürmer und die Erbschaft der Vergangenheit
Dann aber sind neben Herrn Schabowski noch andere Männer im Leben der Charly Benz, die gegen den Routinenalltag wirken und in der Form einer verschwärmten Jugendliebe (der Dragoschnig), eines Kulturjournalisten (Hans Hänse Quandt) und eines Akademikernachbarn (Mo Gabler) ihren Auftritt haben. Und natürlich ist da auch der Don, der Vater, der geht und kommt wie es ihm beliebt und der schlussendlich ganz verschwindet und nicht mehr zurückkehrt, weil er aus dem Leben scheidet – der zweite (und – versprochen – letzte) Spoiler dieser mitteilungsbedürftigen Rezension. Sie alle werden zu Platzhaltern in der Familienaufstellung, dieser therapeutischen Planlegung, die doch eigentlich die wahre Basis des Romans zu sein scheint. Denn im ewigen Versuch, zu durchblicken, welche Ansprüche das Leben an uns stellt, wechseln Familienmitglieder und Platzhalter ihre Positionen und sorgen für immer neue Voraussetzungen.
So mischt sich schließlich Bad Gastein ins Dreiländereck der Lebensmittelpunkte der Protagonistin und mit ihm ein vererbtes Hotel, abgehalftert und nur noch ein Nachhall jener Belle Époque, die früher einmal den Kurort in Salzburg geprägt hatte.
Dorthin, wo verschlungenerweise auch die Wurzeln des Dons liegen, verlagert sich schließlich auch die Handlung; ein Abwandern im großen Stil, denn nicht nur Charly Benz und ihr Postengel landen in der österreichischen Bergwelt, die erweiterte Familie samt Männerverstrudelungen und der in Charly Benz heranwachsenden Auswirkung findet sich ein.
Was dort geschieht?
Superlativen natürlich. Es wird auf das Leben gewartet. Und auf den Tod. Auf das Kommen und das Gehen.
Die Kunst der Hyperbel
Wie es Verena Rossbacher gelingt, einen Roman zu komponieren, der in seiner Vielschichtigkeit nicht in unerträglicher Handlungsüberladung endet, ist ihrer Erzählkunst zu verdanken. Während nämlich auf der einen Seite die Ereignisse einander ebenso nachhasten, wie Namen und Figuren auf die Lesenden losgelassen werden, bleibt alles durch die Ich-Erzählerin ein organischer Bestandteil der erzählten Lebensrealität.
Auf diese Weise sind wir geneigt, die Grillen zu akzeptieren, die die Protagonistin über Andere offenbart oder auch ihrem eigenen Ausufern mit Neugierde zu folgen. Dieses Ausufern wird natürlich durch den Postengel Herrn Schabowski entlarvt und thematisiert, bevor Literaturkritiker*innen zum Schachzug kommen könnten:
„Meine Liebe, ich muss Sie einmal mehr darauf hinweisen, dass Sie übertreiben – wirklich, Sie überzeichnen sich -. Was soll das bringen, dass Sie sich selbst immer wieder darstellen, als wären Sie die Protagonistin einer schlechten Sitcom?“ (S.167)
Charly Benz übernimmt die Verteidigung selbst in diesem Roman, der die Gedanken seiner Hauptfigur generös ausbreitet und bei einem Hang zur Oralität mitunter an Erzählerfiguren wie aus Wolfs Haas‘ Brenner-Romanen gemahnt. An dieser Stelle aber beruhigt sich die Protagonistin und ihr Erzählfluss siedet auf umsichtige Reflexion zusammen:
„Kann schon sein, Herr Schabowski, kann schon sein, dass ich da und dort ein bisschen übertreibe, aber es ist doch so: Es ist ein merkwürdiges Phänomen, dass ein Mann mit ähnlich zerpflücktem Äußeren wie ich durchaus eine gewisse charmante Attraktivität entfalten kann, man schließt aus den zahlreichen Kalamitäten auf eine gute Portion Humor und das ist schön, denn vor einem Mann mit Humor muss man sich nicht fürchten und hat viel Spaß. Interessanterweise nützt einer schönen Frau Humor überhaupt nichts, vermutlich, weil er der natürliche Feind der Anmut ist. Und das war haargenau mein Problem.“ (S. 167f.)
Stimmt es, dass es Charly Benz an charmanter Attraktivität fehlt? Das liegt am Ende wohl in den Augen der Leser*innen. Vielleicht ist sie den einen zu laut und schräg, den anderen zu mühsam, wenn sie vier narrative Umwege samt Ehrenrunden nimmt, bevor wir (und mit uns Hans Hänse Quandt) endlich erfahren, warum sie bei Stichwort Leonard Cohen an ihre Tante Vivienne denken muss.
Dann aber wieder perlen aus dem Erzählstrom der Protagonistin Erlebnisse und Gefühle, die einen komplexen Charakter mit narrativem Fleisch füllen und dabei zwischen Humor und Ernsthaftigkeit changieren, zwischen dem Begrüßen des neuen Lebens und dem Akzeptieren der Tatsache, dass am Ende eben das Ende steht.
Große Themen in leichtfüßige Schwere gewebt, eingepackt in das rosa Stanniolpapier der Mon Chéri Pralinen.
Der Nachgeschmack ist warm und zartbittersüß.
Iris Gassenbauer
|
|
| |
|
|
|

|
_______________________________
Jänner 2024
|
|
|
Rudolf Bischof; Klaus Gasperi: Weil wir im Herzen barfuß sind. Ein Lesebuch zu Advent und Weihnachten.
Tyrolia 2023
Zum Jahresende hin werden die Tage kürzer. Nicht nur, was die Tageslichtstunden angeht, die bis zum 21. Dezember mehr und mehr zusammensieden, bis sie sich dann in einer gemütlichen Kehrtwende wieder auszudehnen beginnen. Das Endjahr scheint es eilig zu haben. Vor Weihnachten muss noch eine lange Liste an Aufgaben abgearbeitet werden. Bekannte müssen getroffen, Karten geschrieben, Rechnungen beglichen, Einkäufe getätigt, Wäsche gewaschen und wieder abgenommen werden.
Die Dringlichkeit der letzten Tage kulminiert dann in den oft nur dem Hörensagen nach stillen und besinnlichen Weihnachtstagen, die durch den logistischen Aufwand gestundet sind, sowohl die eine, als auch die andere Familie zu besuchen, das Rotkraut auf den Punkt zu garen und gleichzeitig den Panettone bei der Mitzi-Tante samt einem hektischen Kuss auf deren Wange abzuliefern, bevor der Sternspritzerabend Nostalgie wecken soll. Wer nach dem Stefanietag noch Kraft hat, schafft es aus dem Bett auf die Couch und macht es sich dort mit frisch geschenkter Lektüre und der halb geleerten Keksdose vom Nachbarn gemütlich. Weil aber bei vielen nach den Feiertagen die Batterien erst mal leer sind und sie geduldig wieder für ein letztes Aufbäumen geladen werden müssen, das für kulinarische Durchhaltigkeit beim Silvesterfondue, 12-minütiger Donauwalzertanzeinlage und dem folgetäglichen Mitklatschen beim live übertragenen Radetzkymarsch sorgt, bleibt zwischen den Jahren wenig Zeit für stilles und intensives Lesen.
Wir haben deswegen einen besonderen Lesetipp für Sie mit ins neue Jahr genommen und hoffen, dass nun die kalten Jännerstunden dafür geeignet sind, den berührenden, poetischen und spirituellen Texten nachzufühlen, die der Seelsorger Rudolf Bischof und der Theologe Klaus Gasperi zusammengestellt haben.
„Weil wir im Herzen barfuß sind“ zelebriert nicht nur die Weihnachtszeit und den Advent, auch wenn die Textsammlung, die nun nach über 20 Jahren zum ersten Mal als ästhetisch ansprechendes Hardcover bei Tyrolia aufgelegt wurde, dies im Titelzusatz nahelegt. Es sind die stillen Stunden und die Stunden des Besinnens und des Hoffens, die hier literarisch durchleuchtet werden und die – jede für sich – Raum fordern für das Einbringen eigener Gedanken.
Immer noch finden Menschen das Glück im Kleinen und Unvermuteten. […] Das ist der Grund, warum wir es wagen, in diesem Buch Geschichten und Texte anzubieten, die vorerst nichts mit Nostalgie und Romantik zu tun haben, die aber aufmuntern zu suchen zu finden, lassen uns die Herausgeber im Vorwort wissen (S.10), und reihen als erste Gedicht „Der Stern“ der Wiener Lyrikerin und Kinderbuchautorin Christine Busta.
Nachts erwachen und mit herrlichem Erschrecken
hell im Fenster einen Stern entdecken
und um ihn die sichre Angst verlassen,
wie Kolumbus nach dem Steuer fassen,
und gehorsam wie aus Morgenland die Weisen
durch die Wüste in die Armut reisen,
und im Stern des Engels Antlitz schauern:
wie ein Hirt zu Bethlehem vertrauen.
(S. 13)
Viele Sterne sind noch zu entdecken in diesem Lesebuch, das dazu einlädt, es nach jedem gelesenen Text zu schließen und zufällig an einer anderen Stelle zu öffnen. Denn in ihrer Verschiedenheit hängen sie doch eng zusammen, die Texte, die von Ernüchterung und Verfolgung, von Bedrängnis und Angst erzählen und dabei nicht auf die Hoffnung vergessen.
Du brauchst Gott
weder hier
noch dort
zu suchen.
Er ist nicht ferner
als vor der Tür des Herzens.
(S. 69)
Diese Zeilen stammen von Meister Eckhart, der zwischen Augustinus und Eligius Leclerc ebenso im Lesebuch anzutreffen ist, wie Hilde Domin, Else Lasker-Schüler oder Selma Lagerlöf. Es sind die (gar nicht) stillen Stunden der Weihnachtstage, die im Lesebuch zwischen Licht und Finsternis changieren, die gleichzeitig bedrücken und ermuntern dazu, Hoffnung zu fassen. Ergänzt werden sie von Lyrik und Prosa, die artverwand in die Sammlung passt – hier darf voll und ganz auf Rudolf Bischofs und Klaus Gasperis bedächtigen Auswahlprozess vertraut werden. Die Neuauflage des Lesebuchs, das die letzten Jahre über auch in zweiter Auflage vergriffen war, füllt somit eine Lücke der wohltuenden Multiperspektivität und der Mehrstimmigkeit.
So lässt unser Lesetipp auch Worte des Sufismus erklingen, die ihre Aktualität über die Tage des Advents und der Weihnachten hinaus nicht verlieren und die hier abschließend zitiert werden solle:
Schreibe das Unrecht,
das man dir antut,
in den Sand,
doch schreibe das Gute,
das dir widerfährt,
auf marmorne Tafeln.
Lass alle Gefühle wie Groll
und den Wunsch nach Vergeltung fahren,
sie schwächen dich nur,
doch halte fest an Gefühlen
wie Dankbarkeit und Freude,
die dich stärken.
(S.171)
Iris Gassenbauer
|
|
|
|

|
_______________________________
Dezember 2023
|
|
|
Michael Hammerschmid: stopptanzstill. Wiener Tier Figuren Gedichte.
Picus und Wien Museum 2023
Die Wiedereröffnung des Wien Museums am Karlsplatz lenkt den Blick zuallererst auf die architektonisch faszinierende Verbindung von Alt und Neu: Der neue Betonblock scheint aus der Mitte des historischen Gebäudes herauszuwachsen und legt sich als schwebende Konstruktion über den Bau von Oswald Haerdtl.
Die Symbiose stellt eine transparente Fuge her, sodass die beiden Teile einander nicht zu berühren scheinen und dennoch miteinander verbunden sind. Dieses Konzept des Architektenteams Čertov und Winkler + Ruck spiegelt sich leitmotivisch in einem Gedichtband wider, der – an Kinder adressiert und damit natürlich ein All Ager – zur Wiedereröffnung des Wien Museums erschienen ist: Der Lyriker Michael Hammerschmid geht von Ausstellungsobjekten des Museums gleichermaßen wie Figuren und Skulpturen des Wiener Stadtbilds aus und stellt in Gedichtform eine Symbiose zwischen kunstgeschichtlichem Körper und Textkörper her.
Mittig gesetzt mutet den Gedichten ein schwebender Charakter an, wenn sie bildlich je Doppelseite gemeinsam mit jenem bild- oder skulpturhaften Wesen präsentiert werden, auf die der Text reagiert. Und damit eine spezifische Variante der Ekphrasis inszeniert.
„und meine lamellenborten horten die zeit
die in mir klingt wenn das kind in mir singt“
Es ist der in seiner Körperlichkeit üppige Wal aus Kupferblech vom Gasthaus „Zum Walfisch“ im Prater, der seinen Weg als Blickfang in die Eröffnungsausstellung gefunden hat, aus dessen Perspektive das lyrische Ich hier die Brücke über Seiten und Zeiten schlägt: Aus dem Jahr 1951 stammend, ist der Wal das einzige der Tiere, das mehr Platz für sich beansprucht als nur eine Doppelseite.
Denn ja, es sind allesamt Tierfiguren, von denen Michael Hammerschmid ausgeht – und damit einen Kontrapunkt zu seinem mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendliteraturpreis ausgezeichneten Gedichtband „wer als erster“ setzt. Dort war es der Versuch, Kinderlyrik (auch) jenseits des beliebten Tiergedichts zu erproben. Und nicht zuletzt Illustratorin María José de Telleria, die in ihren Illustrationen Michael Hammerschmids Sprach- in Tierbilder transformiert hat.
Nun sind es Tierfiguren unterschiedlichster Machart, die im Fokus der Text-Assoziationen stehen: Bronze-Figürchen, Mosaike, Wasserspeier, Brunnentiere, Graffitti – sie alle werden in ihrer Materialität mit sprachlichen Mitteln durchdrungen:
„wirf ihnen etwas zu
ein stöckchen aus buchstaben
ein hölzchen aus lauten
einen knochen aus sonnen-
gewärmten heruntergefallenen
sternsilben, wenn du mal welche
findest. dann lachen sie nämlich“
Ein chinesisches Monster aus Stein von der Westfassade des Stephansdoms ist es, das hier unter dem lyrischen Motto „es wird schon gelingen“ aus der Monstrosität befreit werden soll und damit auch den Charakter der Gedichte spiegelt. Sie allesamt verweigern das Liebliche, brechen Sprachrhythmen, irritieren in ihren Zeilenumbrüchen und offenbaren gleichzeitig in ihrer zauber-haften Begrifflichkeit die verborgenen Geheimnisse der Tierfiguren in all ihrer variantenreichen Beschaffenheit. Der Reim wird dabei zurückhaltend und dennoch effektvoll eingesetzt:
„doch jetzt!
ruhe bitte
um was geht
es da? die sieben
zerstieben nicht
fürs foto halten
sie: stopptanz-
still und das ist
für so quasselraben
zeitlich schon viel“
Das Keramikrelief aus der Amortgasse birgt Märchenanleihen, die wie an zahlreichen anderen Stellen des Bandes gleichermaßen wie andere kulturgeschichtliche Aspekte aufgegriffen werden. Und dennoch verweigern sich die Gedichte dem Sagen-haften; vielmehr referieren sie auf die Dynamik der Tierkörper, auf deren Oberflächen gleichermaßen wie die dahinter verborgenen Geheimnisse und Geschichten. Während im Anhang die Kunstgegenstände des Stadtalltags auch in ihrer tier-mythischen Bedeutung verortet werden, erforschen die Gedichte das Unerforschte:
„wohnst du hier?
die den anderen wesen
bist du schon mal
lustig gewesen?“
Es sind eingefangene Momente, in denen die Fantasie zur Fuge zwischen Kunstgegenstand und Sprachkunst wird – ganz so wie jenes Geschoß im neuen Museumsgebäude, das als Glasbau den Blick auf die Stadt freigeben wird. Und damit das Innen und das Außen miteinander verbindet – die Ausstellungsgegenstände und die Tier-Figurationen im öffentlichen Raum. Beide können erkundet werden. Beide sind in diesem Band mit viel Humor erkundet worden:
„es fliegt und fliegt
und fliegt schau hin
als knochen!
und hält
die fledermäuseohren
offen
ich find das so was von
besoffen“
Heidi Lexe
|
|
|
|

|
_______________________________
November 2023
|
|
|
Die aktuellen Lese-Tipps werden auch in Kooperation mit dem Österreichischen Bibliothekswerk in Salzburg, einem unserer Kooperationspartner im Fernkurs für Literatur >>> lyrikLESEN (Oktober 2023 bis Juni 2024) präsentiert:
Sarah Crossan: Toffee
Hanser 2023
Mit der Erinnerung verschwinden wir.
Nicht nur mit der Erinnerung an uns, auch mit der Erinnerung in uns.
Dabei sind Erinnerungen etwas Seltsames. Sie sind die Rexgläser, in die wir das Vergangene gestopft haben; klein geschnitten, mit Essig übergossen und eigenen Gewürzen abgeschmeckt.
Manche Gläser werden Jahre später wieder aus der Speisekammer geholt und mehr oder weniger genussvoll ausgelöffelt, manche sind undicht geworden und zur Hälfte verdampft. Wieder andere sind im Regal ganz nach hinten gerutscht und bleiben dort wohl unentdeckt.
Marlas Vorrat an eingerexten Erinnerungen ist auf einige wenige Gläschen zusammengeschrumpft. So vergisst sie, wo das Salz steht. Oder sie vergisst, dass nicht mehr alle Familienmitglieder am Leben sind. An besonderen Tagen vergisst sie aber auch, dass sie alt ist und alleine in einem zu großen Haus mit zu vielen Dingen lebt. Dann ist sie wieder die sprudelnde, tanzhungrige, junge Frau, die Mami nicht um Erlaubnis bitten will, um Jungs treffen zu dürfen. Marla wohnt in den Schichten der Zeit, die sich um sie gestapelt haben. Jeden Tag und jede Stunde in einer anderen. Und während Marla zwischen Erinnern und Vergessen ihre Realitäten durchlebt, dringt da ein neuer Mensch in ihre Gartenhütte, ihr Haus und schließlich ihr Leben ein.
Allison will den Vergangenheitsspuren, die sich als Bügeleisenabdruck in ihrem Gesicht manifestiert haben, davonlaufen. Will das Geschehene aus ihrem Leben streichen und die Wohligkeit einer stabilen Umgebung einatmen können.
In Marlas Haus mit den vielen Dingen findet sie eine Bleibe. Und Marla findet in der 15-jährigen Allison mit den Vergangenheitsspuren ihre Jugendfreundin Toffee.
Wie es von da an weitergeht?
Es liegt die Schuld der Erzählenden eng an dem Wunsch, etwas besser zu machen. Allison wird zur Wohnungsbesetzerin und zur Sorgenden, zur Freundin und zum Fremdkörper, der je nach Zeitschicht Geborgenheit oder Angst in der alten Frau auslöst.
Sie wird aber vor allem zu einem: Zur Füllmenge im Leben einer Frau, deren Existenz nach und nach zur Leerstelle gerät.
Und dann ist da noch die besondere Form.
Aber reicht es,
Text allein
durch Formatierungskniffe
in die Poesie zu schmeicheln?
Nicht in allen literarischen Beispielen – deren Zahl in den letzten Jahren erfreulicherweise anstieg – gelingt die Übung. Oft dann nicht, wenn aus der Ursprungssprache heraus übersetzt wird. Aber dass es sich bei »Toffee« um einen Versroman handelt, macht das Lesen nach den ersten blocksatzverwöhnten Irritationen bald zur formvollendeten Lektüreerfahrung. Formatierung und Inhalt rhythmisieren sich, verlebendigen die oft knappen Regungen und Gedanken der Ich-Erzählerin und brillieren in der Übersetzung durch Beate Schäfer. So werden auch die ganz großen seelischen Brüche in Allisons Erzählen in stimmstarke Minimalismen gepackt:
Alles, was Dad sagte, war mir ein Rätsel –
Leerstellen ... und Andeutungen, sich kreuzende Wörter
[...]
Die Lösungen waren nie klar.
Im Kreuzworträtseln bin ich gut.
Aber meinen Vater habe ich nie verstanden. (S. 83)
Vergessen und erinnern, Rexgläser oder leere Regale – beide Frauen changieren auf ihre Weisen zwischen Identitäten und zwischen dem Willen, das Erlebte zu bewahren, zu verändern oder ganz hinter sich zu lassen. So steht die Ohnmacht des Vergessens gleich neben dem Vergessen als gefühlsnivellierender Bewältigungsstrategie und bringt Gänsehautsätze mit sich:
Manchmal vergaß ich, dass mein Vater war, wie er war,
und deshalb hatte ich ihn lieb. (S. 134)
Die Vaterfigur als unbeherrschter Brutalo, als bemitleidenswerte Täterfigur, die auf Frust nur mit Gewalt zu antworten im Stande ist, ist der Hort der Verunsicherung und der (auch körperlichen) Qualen, die Allison mit sich davon und in Marlas Haus trägt. Schlussendlich ist ihr Vergessen nur ein zwischenzeitliches; den Vater wieder lieb zu haben und dabei wiedergeliebt zu werden, liefe der Erzählung gegen den Strich. Und auch Marlas Verlust des Erlebten, die Nichtbereitschaft des Sohnes zur Beschäftigung mit der demenzkranken Mutter, die Aussichtslosigkeit, wieder als selbstbestimmter und vertrauensvoller Mensch wahrgenommen zu werden, sind Bausteine einer Narration, die sich nicht um Beschönigungen schert.
Sarah Crossan verteilt keine Happy Ends, streut nicht einmal Hoffnung aus vollen Taschen. Aber dennoch wärmt der Rest an Zuversicht, der über die letzte Seite hinweg hinauserzählt und uns mit dem bittersüßen Geschmack nach ROSINENBRÖTCHEN zurücklässt.
Knirschende Teigkruste,
saftige Rosinen,
geschmolzene Butter,
alles mischt sich
in meinem Mund.
Noch nie habe ich
etwas Köstlicheres
[gegessen]
(S. 34)
gelesen.
Iris Gassenbauer |
|

www.biblio.at

|
_______________________________
Oktober 2023
|
|
|
Die aktuellen Lese-Tipps werden in Kooperation mit dem Österreichischen Bibliothekswerk in Salzburg, einem unserer Kooperationspartner im Fernkurs für Literatur >>> lyrikLESEN (Oktober 2023 bis Juni 2024) präsentiert:
Sabine Gruber: Am besten lebe ich ausgedacht. Journalgedichte
Haymon 2022
Die 1963 in Meran geborene Sabine Gruber lebt heute, nach einigen Jahren Unterrichtstätigkeit an der Venediger Universität, als freischaffende Schriftstellerin in Wien. Sie hat für ihr literarisches Schaffen, das Romane, Lyrik, Erzählungen, Theaterstücke und Essays umfasst, bereits mehrere Auszeichnungen erhalten. Für ihr neuestes Werk hat Gruber 44 »Journalgedichte« zusammen-
getragen, in denen ein lyrisches Ich über den Abschied, das Bewahren und das (Wieder-)Anfangen reflektiert und dabei auf reichlich gesammelte Erfahrungen und Verluste zurückblicken kann: Meine Lebensmänner / Sind alle tot, der Körper ist längst / Nicht mehr im Lot.
Implizit schwingen in den Texten Gedanken über die Endlichkeit des eigenen Daseins und Handelns mit – sie spiegeln sich sogar in Reflexionen über den Prozess des Schreibens und Verwerfens wider: Du aber / Bist im Zerknüllten, im Knitterland / Tot. Beeindruckend ist die Intensität, mit der das Ankämpfen gegen das Vergessen und die Vehemenz des Erinnerns an Orte, Gegenstände, Gerüche und Bilder geschildert wird. Diese Polarität resultiert in einem seltsamen Zweiklang aus dichterischer Traurigkeit und Zuversicht: Schreiben / Um zu lieben, wenn kein Sprechen mehr hilft. Der Titel »Am besten lebe ich ausgedacht« drückt damit zugleich Resignation und steten Neubeginn aus.
In merkwürdigem Kontrast zur Sensibilität der Sprache in den Texten steht ihre strenge Form: Jedes Gedicht umfasst exakt 20 Zeilen. Die zahlreichen Enjambements dürften daher eher der Einhaltung des durchgehenden Schemas als einer lyrischen Funktion geschuldet sein, wobei der Zweck dieser mechanischen Diszipliniertheit nur zu erahnen bleibt.
*bn* Simone Klein
Christoph W. Bauer: an den hunden erkennst du die zeiten. gedichte
Haymon 2022
Der bereits vielfach ausgezeichnete Dichter hat den ersten Zyklus seines Gedichtbands ganz zurecht mit »Cave canem« betitelt: Hüte dich vor dem Hund! Denn Bauer versteht es zu knurren, zu bellen und gelegentlich auch zuzuschnappen. Dies nicht ohne Humor, etwa wenn er den experten für alles in lärmigen zeiten empfiehlt, sich einzugestehen: allemal ich habe keine ahnung aber davon viel. Auch wenn Bauer in Vergangenem, Gegenwärtigem und geografisch weitläufig herumstreunt – von Wattens bis ans Meer bei Trapezunt, ins antike Caesarea und zurück in die Wachau – so karikiert er vor allem den Zeitgeist. Insbesondere die Kunst- und Expert*innenwelt ist nicht sicher vor seinen Bemerkungen.
Bauers Gedichte, in seiner eigenen witzigen Diktion viel Weißraum, der das bisschen Text umgibt, sind in der Tat das Resultat meisterhafter und maximaler sprachlicher Verdichtung. Auch hier gilt: Cave canem! Hüte Dich, denn seine Gedichte sind trotz allen Humors auch Verdichtungen wider die allseits so beliebte Niederschwelligkeit und wollen aktiv erarbeitet werden. Das geht unter anderem aus den vielen doppelsinnigen Enjambements hervor.
Lässt man sich auf eine aktive Lektüre ein, wird der schmale Band zu einem bereichernden Erlebnis!
*bn* Simone Klein |
|

www.biblio.at

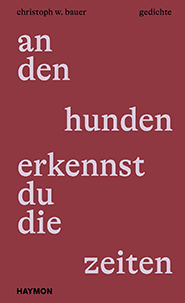
|
_______________________________
September 2023
|
|
|
Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e. V. (Hg.): Ihr habt da was vergessen … Frauengeschichte sichtbar machen.
Leipzig 2022.
Frauen haben schon immer die Gesellschaft geprägt […] und […] Spuren in der Geschichte hinterlassen […] – wir müssen sie nur von dem Staub der Unterdrückung befreien und anfangen, von ihnen zu erzählen.
Von vergessenen – oder besser: aus der Erinnerung und Geschichts-
schreibung (bewusst oder unbewusst) ausgesparten – Frauen, die im 19. und 20. Jahrhundert das Leben in Leipzig und Sachsen geprägt haben, erzählt jenes Leseheft, das im vergangenen Jahr von der
>>> Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e. V. herausgegeben wurde. Produziert wurde das Heft vom >>> fem/pulse-Team der in Leipzig ansässigen Gesellschaft, das es sich zum Ziel gesetzt hat, in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen feministische Impulse zu setzen, indem es sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen* [1] – heute sowie in der Geschichte – einsetzt. Auf 46 äußerst lesenswerten Seiten werden in dem auch optisch sehr ansprechend gestalteten Heft elf Frauen vorgestellt, die sich im Laufe der vergangenen 200 Jahre in Leipzig (und darüber hinaus) für gesellschaftliche Veränderungen und die Gleichberechtigung von Frauen* eingesetzt haben und die in unserer – männlichen geprägten – öffentlichen Erinnerungskultur oft nicht oder zu wenig beachtet werden.
Schriftstellerinnen und Künstlerinnen, Sportlerinnen und Aktivistinnen, Arbeiterinnen und Wissenschaftlerinnen – die in dem Leseheft porträtierten Frauen haben vielfältige Leben gelebt und sich in vielfachen Bereichen (von Arbeit und Sport über Körper und Sexualität bis hin zu Kunst und Politik) für Frauenrechte und Emanzipation engagiert. So etwa die Dichterin, Schriftstellerin, Journalistin und Frauenpolitikerin, die der Gesellschaft ihren Namen gab: Tatsächlich ist das Wirken von Louise Otto-Peters so vielseitig, dass es kaum in ein paar Sätzen zusammengefasst werden kann. 1849 – in einer Zeit, in der es Frauen verboten wurde, Zeitungen herauszubringen – gründete sie etwa eine »Frauen-Zeitung«, in der sie schon früh das Grundsatzprogramm der deutschen bürgerlichen Frauenbewegung ausformulierte. Weitere der im Heft vorgestellten Frauen sind etwa die Autorinnen Auguste Schmidt und Elsa Asenijeff, die Künstlerinnen Käthe Kollwitz und Gerda Taro, die Widerstandskämpferin Maria Grollmuss, die Juristin Elsa Hermann oder die Ärztin und Sexualwissenschaftlerin Lykke Aresin.
Jeder Frau wird dabei eine Doppelseite gewidmet, auf der zentrale Informationen zur Person zusammengefasst werden und Beispiele aus ihren jeweiligen Arbeiten präsentiert werden. Oftmals handelt es sich dabei um Textausschnitte aus politischen Reden, wissenschaftlichen Beiträgen oder literarischen Publikationen; an anderer Stelle wiederum sind es Fotografien, Gemälde oder Plakate, die Einblick in das Schaffen der – stets auch fotografisch ins Bild gesetzten – Frauen geben. Ergänzt werden diese kurzweiligen Vorstellungen durch Anregungen zur weiteren Auseinandersetzung mit den Porträtierten und ihren jeweiligen gesellschaftspolitischen Kontexten. Diese beinhalten nicht nur konkrete Fragen, Denkimpulse und Ideen für Arbeitsaufträge, sondern stellen auch Hinweise zu weiterführenden Quellen bereit – was das Heft zu einem idealen Arbeitsmaterial für Schule und Bildung macht.
Es ist eine differenzierte gesellschafts- ebenso wie selbstkritische Perspektive, die die Verfasserinnen Pina Bock, Nane Pleger und Katharina Wolf in ihrem Leseheft einnehmen. Dabei zeigen sie nicht nur, wie ein eindimensionaler Blick auf [Geschichte und] Geschichtsschreibung die Sicht auf das Schaffen und die Kämpfe vieler Frauen* oftmals einschränkt oder gar versperrt, sondern schreiben auch gemeinsam gegen das Vergessen und gegen das »Ent_Innern« [2] dieser Frauen und ihrer Geschichten an. Dies tun sie aus einer bewusst gesetzten intersektionalen Perspektive, die das Zusammenwirken verschiedener Diskriminierungsformen wie Sexismus, Klassismus, Queerfeindlichkeit und Rassismus berücksichtigt. Für manche sperrig klingende Konzepte wie »Intersektionalität« werden dabei ebenso anschaulich wie praxisorientiert erläutert und konsequent in die Darstellungen integriert. So geht das Heft etwa auch auf die Unterschiede in den Kämpfen und Anliegen der bürgerlichen und der proletarischen Frauenbewegung ein – und zeigt auf, dass die in der Leipziger Arbeiter*innenbewegung engagierte Clara Zetkin mit ihrer Beschreibung der doppelten Unfreiheit der Proletarierin schon früh – ja, tatsächlich avant le lettre – Konzepte wie Intersektionalität gedacht und gelebt hat.
Dem Umstand, dass Frauen* oft doppelt (und mehrfach) benachteiligt werden und daher auch oft aus der Erinnerung doppelt [und mehrfach] heraus[fallen], tragen die Verfasserinnen aber nicht nur in den von ihnen vorgestellten Frauenporträts Rechnung, sondern auch wenn sie am Ende des Heftes die nach wie vor bestehenden blinden Flecken in unserer Erinnerung sichtbar machen. Die letzte Doppelseite wird leer gelassen – und spiegelt so die weißen Leerstellen des kollektiven Gedächtnisses wieder: Während etwa Schwarze Frauen das gesellschaftliche Leben im 19. und 20. Jahrhundert sicherlich mitgeprägt haben, wissen wir nach wie vor zu wenig über die Geschichte nicht-weißer Frauen* in Leipzig (sowie aus vielen anderen Regionen Deutschlands, Österreichs oder der Schweiz). Daher werden an dieser Stelle auch die Leser*innen des Hefts dazu eingeladen, ihr eigenes Wissen in den Dialog einzubringen, sich einzumischen, bestehende Leerstellen mithilfe von geteiltem Wissen zu schließen – und so gemeinsam die Geschichten von Frauen* weiterzuerzählen.
Es gibt also noch viel zu tun UND es ist schon so viel passiert.
Lasst uns (weiter) darüber sprechen.
Claudia Sackl
Das Leseheft »Ihr habt da was vergessen … Frauengeschichte sichtbar machen« (2022) ist kostenlos auf der Homepage der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft als >>> Download verfügbar oder gegen eine Postversandgebühr auch in gedruckter Ausgabe erhältlich.
Detaillierte Informationen finden Sie hier: www.louiseottopeters-gesellschaft.de/leseheft-fempulse.
Fußnoten:
[1] Die Schreibung von Frauen* mit Sternchen wird dazu genutzt, um auch nicht-cis-Frauen – etwa transsexuelle, Transgender- oder nicht-binäre Personen, die sich als Frau* identifizieren – im Begriff »Frau*« miteinzuschließen.
[2] Mit dem Konzept des »Ent_Innerns« beschreibt der Berliner Kultur- und Politikwissenschaftler Kien Nghi Ha eine reproduktive Erinnerungshandlung, die gewisse Geschichte(n) – meist jene marginalisierter Gruppen – verschweigt und enthistorisiert, während sie die Darstellung von Geschichte(n) aus der Perspektive der Herrschaftsgruppe normalisiert.
Vgl. Kien Nghi Ha: Macht(T)raum(a) Berlin – Deutschland als Kolonialgesellschaft. In: Maureen Maisha Eggers / Grada Kilomba / Peggy Piesche / Susan Arndt (Hg.): Mythen, Masken, Subjekte. Kritische Weißseinsforschung in Deutschland. Münster: Unrast 2005, S. 105-117. |
|

www.louiseottopeters-gesellschaft.de
|
_______________________________
Sommer 2023
|
|
|
Sharon Dodua Otoo / Jeannette Oholi (Hg.): Resonanzen – Schwarzes Literaturfestival. Eine Dokumentation
Spector Books 2022
Wieder sind die Tage der deutschsprachigen Literatur (kurz: der Bachmannpreis – die wohl fulminanteste und medienwirksamste Literaturshow im deutschsprachigen Raum – voll im Gange. Und auch Sharon Dodua Otoo, die Autorin der abschließenden Kurslektüre >>> »Adas Raum« (S. Fischer 2020) im Fernkurs für Literatur »nachLESEN«, ist mindestens auf zweifache Weise mit dem Klagenfurter Wettlesen verbunden. 2016 nahm sie selbst daran teil und gewann mit ihrem Text »Herr Gröttrup setzt sich hin« auch prompt den Hauptpreis; 2020 hielt sie schließlich die Klagenfurter Rede zur Literatur, die unter dem Titel >>> »Dürfen Schwarze Blumen malen?« auch in Buchform publiziert wurde. Mittlerweile ist die in London geborene Berlinerin zu einer zentralen Figur der Schwarzen deutschsprachigen Literatur geworden, die sie nicht nur als Autorin, sondern auch als Herausgeberin, Kuratorin und Aktivistin prägt. 2022 organisierte sie so etwa erstmals das Schwarze Literaturfestival »Resonanzen«, das auch dieses Jahr wieder im Rahmen der »Ruhrfestspiele Recklinghausen« stattgefunden hat.
Ein Ingeborg-Bachmann-Preis Wettbewerb mit ausschließlich Schwarzen Literaturkritiker_innen und Schwarzen Autor_innen – als solches wurde das Projekt im Oktober 2020 als Intervention in den nach wie vor viel zu weißen deutschsprachigen Literaturbetrieb geboren. Wettkampf wurde es im Mai 2022 dann zwar keiner, konstruktive Kritik gab es aber allemal: Sechs Autor*innen trugen eigens verfasste Kurztexte zum Thema »Erbe« vor, vier Literaturkritiker*innen diskutierten im Anschluss über das Vorgelesene und mit den Vorlesenden. Wer die bemerkenswerten Texte von Raphaëlle Red, Joe Otim Dramiga, Bahati Glaß, Winni Atiedo Modesto, Melanelle B. C. Hémêfa und Dean Ruddock sowie die aufschlussreichen Wortmeldungen der Jury – bestehend aus Aminata Cissé Schleicher (Germanistin & Amerikanistin, Mitbegründerin von ISD & EOTO), Elisa Diallo (Literaturwissenschaftlerin & Historikerin, Verlegerin), Ibou Coulibaly Diop (Literaturwissenschaftler & Kurator) und Dominique Haensell (Literaturwissenschaftlerin, Autorin & Chefredakteurin beim »Missy Magazine«) – nachlesen möchte, kann dies in der wertigen, in Buchform publizierten Dokumentation der Veranstaltung tun.
Herausgegeben wurde diese von Sharon Doduo Otoo gemeinsam mit der Literaturwissenschaftlerin Jeannette Oholi. In äußerst ansprechender Aufmachung werden darin nicht nur die Lesungen und Diskussionen der ersten Ausgabe des Resonanzen-Festivals, sondern auch das spannende Rahmenprogramm von 2022 festgehalten. Dieses umfasste unter anderem eine ebenso berührende wie inspirierende Eröffnungsrede von der simbabwischen Schriftstellerin, Filmemacherin und Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels Tsitsi Dangarembga sowie einen zusammenfassenden Kommentar zum Festival von der Diversity-Trainerin Nouria Asfaha (Mitbegründerin & Herausgeberin von »afrolook!«, der ersten Zeitschrift der jüngeren Schwarzen Deutschen Bewegung) – der unter dem Titel »Träume werden wahr« übrigens auch in direktem Anschluss zum Leseheft Nr. 7 aus dem Fernkurs »nachLESEN« gelesen werden kann, in dem die Literaturwissenschaftlerin Susan Arndt das Konzept der »Traum*Hoffnungen« entwirft. Und auch Tsitsi Dangarembga greift in ihrer einleitenden Rede die Fragen auf, wessen Geschichte(n) warum (nicht) erzählt werden, wessen Geschichten(n) im kollektiven Gedächtnis warum (nicht oder zu wenig) erinnert werden und inwiefern Literatur – und ein Literaturfestival – in diese gesellschaftspolitischen (Macht-)Strukturen intervenieren und Einfluss nehmen kann.
Darüber hinaus greifen auch die äußerst vielseitigen literarischen Texte der sechs eingeladenen Autor*innen viele jener Fragestellungen auf, die uns im Laufe des Fernkurses »nachLESEN« beschäftigt haben. So setzt sich etwa Joe Otim Dramige seinem Text »Adlam« mit Literatur und Sprache – in Form von Büchern, aber auch Alltagserzählungen – als Speicher von Wissen auseinander und erzählt dabei nicht nur eine nicht genug erinnerte Geschichte über eine große geopolitische Zäsur in Mali, sondern thematisiert auch das widerständige Potential verschütteter Schriften – und hinterfragt zugleich die dominante Rolle von Schriftlichkeit in der Tradierung von Wissen. Seinem Text stellt er folgendes Zitat von Malcolm X voran, in dem der afroamerikanische Aktivist und Bürgerrechtler das enge Zusammenwirken von Vergangenheit und Zukunft betont:
Armed with the knowledge of our past, we can with confidence charter a course for our future. Culture is an indispensable weapon in the freedom struggle. We must take hold of it and forge the future with the past.
Mit Zitaten – in diesem Fall aus verschiedenen Musiksongs – arbeitet auch Dean Ruddocks Text »pareidolie«, der entlang einer Playlist aus lyrics/Lyrik-Fragmenten von einer Reise ins All berichtet. Ähnlich der im Hip-Hop üblichen Sample-Technik collagiert der Autor dabei seinen Text, der im Erzählen über eine Zukunft im (kolonisierten) Weltraum darauf verweist, was eigentlich immer schon gewesen ist. Die Apokalypse [ist] eben schon lange passiert, bringt es Dominique Haensell in ihrem Kommentar auf den Punkt. Kapitalismuskritik trifft dabei auf Afro-Futurismus, die Grenzen zwischen Poesie und Musik werden porös und aus Altem entsteht Neues.
Neue (Erzähl-)Welten entwerfen auch die anderen vier, hier aus Platzgründen leider nicht näher besprochenen Texte, wenn Sie von vielschichtigen afrodiasporischen Lebensrealitäten und Zugehörigkeiten – zwischen veganer Leberwurst, schneebedecktem Zuckerrohr und vom Haare-Braiden ausgelösten Madeleine-Momenten – erzählen.
Neue, wichtige Wege hat Sharon Dodua Otoo mit dem Schwarzen Literaturfestival, das sie ins Leben gerufen hat, beschritten.
Neue Wege eröffnet sie auch mit der vorliegenden Printpublikation, dank der auch jene, die 2022 nicht vor Ort sein konnten, diesen Spuren folgen können. Sie ist ein Buch für alle, die auch nach dem Bachmannpreis noch nicht genug von (Gesprächen über) Literatur haben – alle, die sich für die Vielfalt Schwarzer deutschsprachiger Literatur interessieren – und alle, die an die subversive Kraft von Literatur glauben.
Claudia Sackl |
|

|
_______________________________
April & Mai 2023
|
|
|
Raphaela Edelbauer: Die Inkommensurablen
Stuttgart: Klett-Cotta 2023
Nein, das waren keine Menschen mehr, es war eine Masse. Grobkörnig war dieser Zug und doch ganz uniform. Etwas gestern noch Mannigfaltiges war vom Gewicht des darauf abgestellten Sommertags zusammengepresst wie von einem kosmischen Glasblock.
Dass Raphaela Edelbauer eine der großen Romancièren der österreichischen Gegenwartsliteratur ist, hätte wohl schon seit ihren letzten Publikationen »Das flüssige Land« (2019) und »Dave« (2021) niemand mehr anfechten wollen. Wie derzeit kaum ein*e andere*r schafft sie es, in ihren Texten plastische Sprachwelten zu erschaffen, die gleichermaßen fesseln und verblüffen – so auch in »Die Inkommensurablen«, einem historischen Wienroman, der diese Kategorisierung ganz neu denken lässt.
Aber von Beginn weg: Am 30. Juli 1914 wartet ganz Wien in größter Erregung auf das Verstreichen des deutschen Ultimatums gegenüber Russland. An diesem Vorabend des Kriegsausbruchs erreicht der 17-jährige Bauernknecht Hans Ranftler mit dem Nachtzug von Tirol aus die Bahnhofshalle der Hauptstadt. Entgegen der Erwartungen, die ihm von den geschmeidig durchs Gemenge manövrierenden Städter*innen entgegengebracht werden, möchte er sich aber nicht dem kollektiven Kriegstaumel der militärischen Mobilmachung anschließen. Vielmehr ist Hans auf dem Weg zur Praxis der Psychoanalytikerin Helene Cherech, auf deren Annonce er in einer Tageszeitung gestoßen ist. Diese aber vertröstet sein Erstgespräch auf den Folgetag; noch ohne Unterkunft lesen ihn im Vorzimmer die angehende Mathematikerin Klara und der Offizierssohn Adam (ihrerseits beide Patient*innen in der Praxis) auf. Mit ihnen bricht Hans auf in eine über 349 Seiten ausgebreitete Nacht vor der Zeitenwende, die von ihm als Zentrum ausgehend kaleidoskopartig eine Stadt im Ausnahmezustand porträtiert.
Besagtes Kaleidoskop fokussiert Existenzen quer durch die gesellschaftlichen Schichten und auch abseits historisch gut dokumentierter Lebenswelten. Dieser Weitblick gelingt der Autorin durch die Trias ihrer Protagonist*innen: Mit Hans erschreibt sie sich eine Figur, die das bäuerliche aber auch das bürgerliche Leben kennt, Adam ist Spross eines tschechischen Adelsgeschlechts und Klara ist eine akademische Aufsteigerin aus dem Lumpenproletariat. All diese Realitäten werden in ihren sprachlich kunstvoll ausgestalteten Räumen vor der Folie zeitgeschichtlicher Entwicklungen zusammengeführt, wobei vermutlich auch historisch bewandte Leser*innen sich auf teils unbekanntem Terrain wiederfinden werden, wenn etwa die Tätigkeiten feministischer Clubs, queere Lebenswelten oder (wortwörtliche) Lokale im Untergrund zur Sprache kommen. Die Autorin biedert sich in diesem groß gedachten Unterfangen keiner historisierenden Sprachverwendung an, sondern findet ihren eigenen kunstvollen Ton voller überraschender Wortschöpfungen, der ihr erzähltes Wien in seiner Vielstimmigkeit und Vielsprachigkeit erfahrbar werden lässt.
Dass sich Hans, Klara und Adam in dieser Dreierkonstellation vor Helene Cherechs Praxis begegnen, ist überdies kein Zufall. Alle drei sind Träger*innen einer parapsychologischen Gabe. Hans merkt, wie seine Gedanken sich unheimlich gehäuft zwischen ihm und seinen Mitmenschen (in deren Unwissen) übertragen. Adam ist Gefäß fremder Erinnerungen. Klara hat eine zentrale Rolle im sogenannten Säkulumsculster inne. Der Säkulumscluster – das ist das massenpsychologische Phänomen, dessen Erforschung sich Helene Cherech verschrieben hat. Nacht für Nacht finden sich offenbar zahlreiche Menschen, insbesondere aus den Ländern des Kaiserreichs, im immerselben Traum wieder. Alle drei also haben es mit Erfahrungen zu tun, die über ihre Individualität und leiblichen Grenzen hinausgehen. Diese Gaben genauso wie der Cluster sind Varianten des dem Titel entsprechend unfassbaren Motivs der Masse, das in »Die Inkommensurablen« vielgestaltig verhandelt wird. Die Autorin spürt ihren Ausprägungen nach, ihrem Entstehen und ihrer Anziehungskraft, ihren Bewegungen und Handlungen.
In einem beeindruckend lebendig und anschaulich erzählten Wien, zwischen Politik, Psychologie und Verweisen auf zeitgenössische Esoterik, erkundet der Roman die Dynamiken menschlicher Massenphänomene und bleibt dabei trotz unbestrittener Aktualität seinem historischen Interesse treu. Der Text funktioniert als Reflexionsmöglichkeit beider zeitlicher Ebenen wohl gerade deshalb, weil vergleichbare Entwicklungen eben nicht zeitlich oder örtlich gebunden sind. Oder, wie es Adam Hans gegenüber treffend formuliert: Man kann jeden manipulieren, mein Freund, wenn man nur die richtigen Knöpfe findet.
Sarah Auer |
|

|
_______________________________
März 2023
|
|
|
Thomas Cadène / Benjamin Adam: soon
Aus d. Französischen v. Ulrich Pröfrock
Lettering v. Minou Zaribaf
Hamburg: Carlsen 2020
Science Fiction. Dystopie. Utopie? Climate Fiction. Near-Future Fiction. Future History. – Die von den beiden französischen Comic-Künstlern Thomas Cadène und Benjamin Adam kreierte Graphic Novel »soon« kann mit vielerlei Labels versehen werden. Geeint werden die unterschiedlichen, ineinander verschränkten Genre- und Motivtraditionen durch ein gemeinsames Anliegen: Die Frage, wie unsere Welt in der Zukunft aussehen könnte, wie diese Zustände beschrieben werden können und wie wir in der Zukunft (genauer gesagt im Jahr 2151) wohl über unsere unmittelbare Vergangenheit sprechen werden.
In einer eindrücklichen, durchaus unkonventionellen Bild-Text-Welt entwirft »soon« ein zukünftiges Szenario, in dem Klimakatastrophen, Kriege und Pandemien zu einer Apokalypse geführt und die Menschheit auf ein Zehntel der Bevölkerung dezimiert haben. Die Übriggebliebenen leben in sieben urbanen Zentren; ihr Alltag, ihr Energieverbrauch und ihre Bewegungen werden streng reglementiert, denn die Ressourcen der Erde neigen sich dem Ende zu. Während die verschiedenen Stadtzonen in Asien, Afrika und Amerika – in Europa scheint keine nennenswerte Zivilisation überlebt zu haben – von ihrer Umgebung abgeschottet werden, dürfen die (offiziell) nicht bewohnbaren – weil entweder zerstörten/verstrahlten oder geschützten – 88 % der Erdoberfläche nur von qualifiziertem Forscher- und Arbeitspersonal betreten werden, das die Regeneration der Natur penibel überwacht. In einem für diese Zwecke eingerichteten Labor befindet sich unser Protagonist Juri in der Lehre, als er von seiner Mutter Simone in die Stadt (New Winnepeg, Nordamerika) zurückbeordert wird: Sie steht kurz vor ihrem Aufbruch zu einer Weltraummission ohne Wiederkehr, die im Rahmen des sogenannten SOON-Projekts untersuchen soll, ob die Menschheit auf dem mehrere Lichtjahre entfernten Planeten Proxima Centauri B eine Zukunft haben könnte. Ihre von Presseterminen begleitete Weltreise durch die verbliebenen Stadtzonen unternimmt Simone gemeinsam mit Juri. Dieser ist jedoch wenig interessiert an einer emotionalen Aufarbeitung der Mutter-Sohn-Beziehung, sondern erkundet stattdessen in adoleszenter Selbstbefragung und -bewährung die elternfreien Zonen der jeweiligen Stadt: Ähnlich utopischer Gattungstraditionen bereist der Protagonist die (für ihn ebenso wie für uns) fremde Welt, die wir anhand seiner Erfahrungen und Reflexionen näher kennen- und hinterfragen lernen.
Das ist ein Erzählstrang der vorliegenden Graphic Novel, der in einzelnen Episoden in unterschiedlichen Pastelltönen aufgefächert wird – und der theoretisch gesehen auch stringent als separate Erzählung gelesen werden könnte. Unterbrochen wird die fortlaufende Handlung im Jahr 2051 jedoch regelmäßig von dokumentarischen Einschüben, die historische Sachinformationen zu der erzählten Zukunftswelt liefern. Scheinen diese zunächst wie auktoriale Erzählerkommentare aus dem Off, wird bald klar, dass sich hier eine deutlich komplexere und durchdachtere Erzählkonstruktion auftut: Denn es handelt sich hierbei vielmehr um Fragmente einer Erinnerungskultur, die Juri (in unterschiedlichen Altersstufen) im Dialog mit seiner Mutter oder Freunden aushandelt. Dies geschieht stets in mediatisierter Form. Mal hilft Simone ihrem Sohn beim Lernen für eine Geschichtsprüfung – zwischen den beiden Juris Tablet, auf dem er seinen Lernstoff in einer vielverzweigten Timeline und unterschiedlichen Infografiken notiert. Mal spazieren sie durch ein interaktives Geschichtsmuseum, dessen Böden und Wände aus Panels bestehen. Die unterschiedlichen Erzählebenen (die jeweiligen Meta-Bilder und die im Gespräch befindlichen Figuren) weiß Benjamin Adam dabei stets auf geniale Weise ineinander zu verweben. Er erschafft nicht nur (detaillierte, verschachtelte) Räume in Panels, sondern platziert seine (Körper-gewordenen) Panels auch im Raum. Die Figuren wiederum bewegen sich häufig nicht innerhalb, sondern außerhalb der Panels durch das Weltall-blaue Gutter, dessen strikte geometrische Struktur mal subtil, mal gänzlich aufgebrochen wird.
»soon« zeichnet sich aber nicht nur seinen klugen, experimentellen Umgang mit seiner Seitenarchitektur aus, sondern hinterfragt auch auf gesellschaftspolitischer und philosophischer Ebene, wie aus dem Zukünftigen ebenso wie aus dem Vergangenen Sinn erzeugt werden kann. Jene Sequenzen, die retrospektiv auf unsere unmittelbare Zukunft blicken, erzählen nicht einfach linear die Historie dieser zukünftigen Welt nach, sondern hinterfragen durch ihre dialogische Struktur die autorisierte Geschichtsschreibung und zeugen so von dem Spannungsverhältnis zwischen dem kanonisierten kollektiven Gedächtnis der Zukunftswelt und alternativen Erinnerungsformen. Die dichte Struktur der Graphic Novel wird zudem immer wieder durch unterhaltsame Details aufgelockert. Beispielsweise, wenn Oprah Winfrey in Zeitungsausschnitten aus dem Jahr 2034 als US-amerikanische Präsidentin auftritt, während unter den Schlagzeilen berichtet wird, dass Donald Trump wieder einmal zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde.
Auf beeindruckend und zugleich beängstigend realistische Weise extrapolieren Thomas Cadène und Benjamin Adam in »soon« Entwicklungen unserer Gegenwart und erschaffen eine Zukunft, die uns erschreckend nahe erscheint. Während der Grippe-Pandemie im Jahr 2040 fällt der internationale Zusammenhalt auseinander, als die WHO sich außerstande sieht, eine gerechte Verteilung der Impfstoffbestände zu gewährleisten:
Als das Virus über die Welt kam, musste mangels wirklicher gemeinsamer Politik … / … jedes Land eigenständig mit den Herstellern von Impfstoffen verhandeln. / Die reichsten Länder bekamen mehr Impfstoff.
So fasst Juri vor seiner Timeline zur Gesundheitskrise > 2065 zusammen. Das vor jeglicher Berichterstattung über Covid-19 entstandene, 2019 in französischer Originalausgabe erschienene Buch wirkt heute fast prophetisch, das darin imaginierte Szenario dadurch noch ein wenig unheimlicher – aber keinesfalls weniger faszinierend, wenn es auf höchster Graphic-Novel-Kunst die Zerbrechlichkeit gleichermaßen wie die Widerstandsfähikeit der Erde und der Menschheit literarisiert.
Claudia Sackl |
|

|
_______________________________
Februar 2023
|
|
|
Theresia Enzensberger: Auf See
München: Hanser 2022.
Wenn sich die globalen Krisen häufen, wuchern und verdichten sich auch die (nicht nur literarischen) Erzählungen um den drohenden Zusammenfall menschlicher Ordnungssysteme. Und zwischen historischen apokalyptischen Texten und immer beunruhigenderen Ausdeutungen wissenschaftlicher Prognosen könnten Leser*innen nur allzu leicht zu dem ernüchternden Schluss kommen: Die Welt war eigentlich immer schon am Ende. In Theresia Enzensbergers neuestem Roman »Auf See« wird dieses erwartungsvolle Unbehagen als Ausgangsgefühl in eine nicht genau datierte Zukunft transponiert, die unserer Gegenwart technologisch gesehen noch vergleichsweise nahesteht. Aus (für den Anfang) zwei Perspektiven wird der Erzählraum aufgemacht, jeweils markiert durch eine Überschreibung der Kapitel mit einem Namen: Yada. Helena.
Ihre erste Begegnung machen die Leser*innen mit der 17-jährigen Yada, auf einer vor der deutschen Ostsee schwimmenden Plattform – der Seestatt. Yada ist die Tochter des als Visionär gefeierten Unternehmers, der mit diesem autarken Mikrokosmos eine Zuflucht vor immer unvorhersehbareren klimatischen Entwicklungen und einem kontinuierlichen Verfall der Staatlichkeit unter dem Druck von Großkonzernen bieten wollte. Die Ich-Erzählerin selbst ist seit zehn Jahren hier; damals wurde sie gerichtlich aus der Obhut ihrer Mutter genommen, die an einer rätselhaften psychischen Erkrankung gelitten haben soll. Hier in der Seestatt führt die Jugendliche einen privilegierten aber eintönigen Alltag, der vor allem durch einen strikten Zeitplan rund um Essensausgaben, sportliche Betätigung und Unterrichtseinheiten in naturwissenschaftlichen Fächern, Softwartechnik, Business Strategy oder Leadership Skills geprägt ist. Von den idealistischen Leitern – alles Männer, überhaupt gibt es bis auf einige Arbeiterinnen keine Frauen oder Kinder auf der Plattform – wird die Seestatt zwar immer noch als richtungsweisendes Projekt inszeniert, aber das Scheitern ist dieser baulichen Utopie in ihrer Abnützung und zunehmenden Vereinnahmung durch die Natur schon deutlich eingeschrieben:
Ich betrachtete die Algen, die in der Mulde wuchsen und sich an den Fugen entlang ausbreiteten. Winziges, sternförmiges Grün auf der gräulichen Oberfläche, ein unmerkliches, aber mächtiges Streben nach außen, nach oben. In der Ferne arbeitet der immer gleiche Rhythmus der Windräder, die wie starre Palmen am Horizont standen. In jeder Himmelsrichtung erhoben sie sich über dem Meer. Dazwischen unsere Siedlung, hermetische Waben, wellenförmiges Fiberglas, das einmal weiß geglänzt hatte und durch dessen schmutziges Grau sich jetzt feine Risse zogen.
Es ist jedoch keinesfalls eine moralisch aufgeladene Gegenüberstellung von Natur und Kultur, zu der sich die Autorin hier hinreißen lassen würde; ihr Interesse gilt vielmehr den vielfältigen Verbindungen, die Menschen auf persönlicher und gesellschaftspolitischer Ebene miteinander eingehen. Neben die in die Realität geholte Utopie der Seestatt (deren Substanz – so viel kann verraten werden – nicht nur konkret stofflich, sondern auch ideologisch porös geworden ist) werden andere Bilder von Vergemeinschaftung und Zusammenleben gestellt. Die von protokollartiger Nüchternheit geprägte Sprache Yadas steht zunächst dem Erzählstrang der Künstlerin Helena gegenüber. Helena lässt sich in dieser zunehmend unwirtlichen, spätkapitalistisch geprägten Welt ziellos durch das Berliner Szeneleben treiben. Ihren Erfolg verdankt sie einem viral gegangenen Video, in dem sie wahllos zwölf Prophezeiungen ausgesprochen hat. Wider Erwarten sind viele davon eingetreten, was ihr den Ruf eines modernen Orakels einbrachte. Und: Eine kleine, aber mächtige Fraktion hatte beschlossen, in dem Video ein Kunstwerk und in ihr eine Künstlerin zu sehen. Aus dem Erfolg des Videos heraus hat sie zu Versuchszwecken eine Sekte gegründet, deren devote Mitglieder sie fortan in um horrende Preise verkauften Portraits festhält. Ein Heilsversprechen für die Verzweifelten vor der Endzeitstimmung, für die pragmatische Helena nur eine unbedeutende Intervention in ohnehin abstrusen Gesellschaftsdynamiken.
Ob auf der Seestatt oder am Festland – Theresia Enzensberger beschreibt mit großer sprachlicher Klarheit das alltägliche Leben im permanenten Ausnahmezustand und spürt gesellschaftlichen Machtdynamiken bis in ihre privatesten Ausprägungen hinein nach. Das dabei aufgemachte Changieren zwischen Dystopie und Utopie in den Erzählungen der Protagonistinnen ist mit zwischengeschobenen Fundstücken aus einem zuerst nicht weiter zugeordneten Archiv versetzt. Es sind historische Anekdoten, die nur allzu deutlich zeigen, wie utopisch scheinende Pläne sich häufig in territoriale, wirtschaftspolitische, schlussendlich koloniale Machtansprüche auswachsen. Überhaupt scheint eine der Grundfragen des Romans zu sein, ob aus einer zutiefst kapitalistischen und auf Ungleichheit basierenden Gesellschaftsordnung heraus Utopisches entstehen kann, ohne – so eine der Figuren – die Systeme radikal zu unterbrechen.
»Auf See« ist ein Text, der sich anhand individueller Geschichten entwickelt, dabei aber vor allem Fragen an kollektiv getragene Systeme stellt. So wie sich die einzelnen Erzählstränge mit der Zeit zusammenfügen, werden auch die Verstrickungen unterschiedlicher hierarchischer Strukturen offengelegt. Den Leser*innen wird dabei unbequem vor Augen geführt, wie viel diese fiktive Zukunft eigentlich jetzt schon mit ihrer Gegenwart zu tun hat. Oder, wie es im dem Roman vorangestellten Zitat aus Lord Byrons »Darkness« heißt:
I had a dream, which was not all a dream.
Sarah Auer
|
|
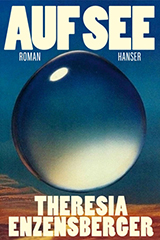
|
|
|
|
